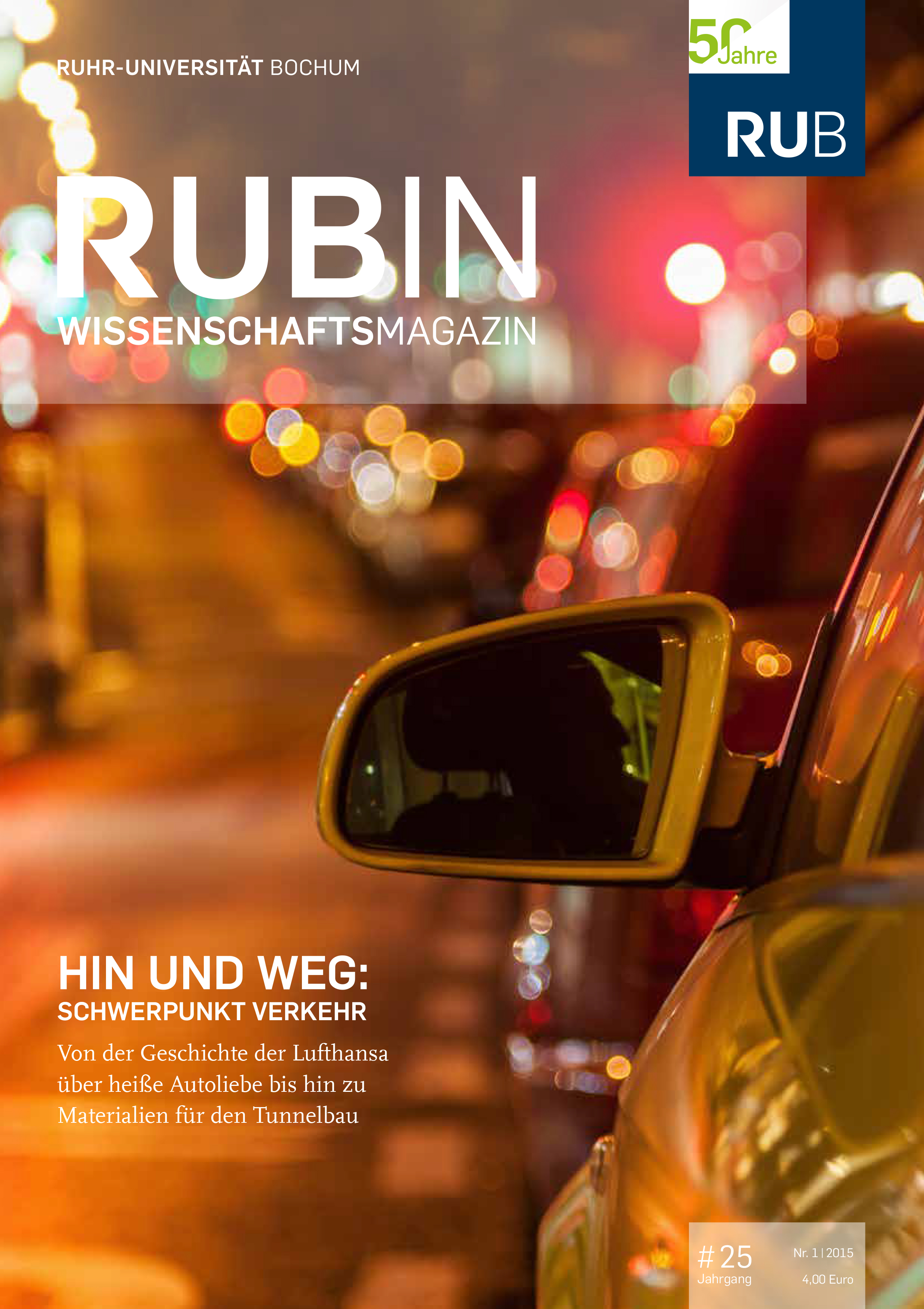Handy-Todesvideos
Das Sterben vor laufender Kamera
Videos von sterbenden Protestteilnehmern der Konflikte in Iran und Syrien tauchen immer häufiger bei Youtube auf. Was lösen sie aus? Wie verändern sie die Medien und unsere Sicht der Dinge?
Teheran, Juni 2009: Verwackelte Bilder zeigen eine junge Frau, die getroffen von einem Schuss zu Boden geht. Unter ihrem Körper breitet sich eine Blutlache aus, Helfer versuchen die Blutung zu stillen, ihre Augen rollen nach hinten, ihr Blick bricht, sie stirbt. Der Tod von Neda Agha-Soltan, aufgezeichnet mit einer Handykamera, schlägt sofort hohe Wellen bei Youtube, wird aufgegriffen von den weltweiten Massenmedien, auch von ARD und ZDF. Die Bilder treten eine starke Welle der Solidarität los mit den Vertretern der sogenannten Grünen Bewegung im Iran, die an diesem Tag gegen die vermeintlich manipulierten Wahlen auf die Straße gegangen war.
Ob Neda zu den Demonstranten gehörte oder zufällig in der Nähe war, ist unklar. Genauso wie unklar ist, ob das Video wirklich ihren Tod zeigt. Vielleicht ist auch alles inszeniert, wie spätere Enthüllungsvideos zeigen wollen und das iranische Regime behauptet.
Für Mareike Meis ist die Frage nach der Echtheit des Sterbens zweitrangig. Sie fragt sich in ihrer Dissertation, was solche Videos diskurstheoretisch und medienästhetisch auslösen. „Handy-Todesvideos“ hat sie sie getauft. Es gab noch keinen Begriff dafür, weil es noch so gut wie keine Forschung zu Handyvideos gibt. „Erstaunlich, weil es Handyvideos schon lange gibt“, meint sie. „Die Forschung konzentriert sich auf das Internet oder Youtube, das Handy als solches wird vernachlässigt.“

Zweiter Ausgangspunkt ihrer Analysen ist das Video eines unbekannten Handyfilmers, der 2011 während des Bürgerkriegs in Syrien seinen eigenen Tod filmt; es wurde von dem libanesischen Künstler Rabih Mroué aufgegriffen und unter anderem bei der „documenta“ gezeigt.
„Zwischen den beiden Filmen und überhaupt zwischen weiteren Filmen aus den beiden Konflikten gibt es einen großen Unterschied“, sagt Mareike Meis. „Die Perspektive wechselt von der des Beobachters zu der des Filmenden.“ Im syrischen Konflikt nimmt der Betrachter häufig die Perspektive des Filmenden ein und im speziellen Fall des Handy-Todesvideos sogar die des Sterbenden selbst.
„Diese Darstellung des Sterbens im Video erscheint zunächst neu, als etwas, das bislang so nicht sichtbar war“, sagt die Forscherin. Wenn man genauer hinsieht, stellt man aber fest, dass die Motive durchaus bekannt sind, zum kollektiven Gedächtnis gehören. „Man denke nur an die Bilder des sterbenden Benno Ohnesorg bei den Studentenprotesten der 1960er-Jahre“, erklärt Meis, „oder an die Fotos von Robert Capa aus dem Spanischen Bürgerkrieg, der Soldaten im Augenblick ihres Todes fotografierte.“
Auch die Kameraperspektive des Sterbenden ist nicht neu. Während des Militärputsches in Chile 1973 filmte Leonardo Henrichsen seinen eigenen Tod durch einen Pistolenschützen der Armee.
Neu ist tatsächlich die Qualität der Bilder des Handys: Ein Foto kann den Moment des Todes nicht darstellen. Man sieht entweder den noch Lebenden kurz vor seinem Tod oder aber den toten Menschen. Außerdem haben Handyvideos eine größere Körperlichkeit als Bilder, die mit einer Videokamera aufgenommen wurden. Man fühlt sich hautnah dabei im Geschehen.
„Das ist wohl auch der Grund, aus dem die Bilder so eine extreme emotionale Wirkung auslösen“, vermutet Mareike Meis. „Die Begegnung mit dem Tod ist intensiver und intimer als zur Zeit der Massenmedien – wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass auch Youtube eine gewisse Auswahl der Videos trifft, die abrufbar sind.“
Die eigene Perspektive hinterfragen
Bei der Recherche, was diese Art von Videos ausgelöst hat, stieß die Forscherin unter anderem auf etwas, das sie Mocking Death Videos getauft hat: Filme, die eine vermeintliche Hinrichtungssituation zeigen, bei der im letzten Moment zum Beispiel getanzt oder ein Horrorgesicht eingeblendet wird.
„Manche dieser Filme sind sicherlich nur zum Spaß gedreht und wollen die Naivität des Betrachters vorführen“, schätzt Meis, „aber einige haben auch eine Botschaft. Da wird der Zuschauer am Schluss beschimpft, wie krank es ist, sich solche Filme anzusehen.“ Momente, in denen der Forscherin klar wird, dass sie auch ihre eigene Perspektive immer wieder hinterfragen muss. Dass die Betrachtung von Todesvideos mit Angstlust, Voyeurismus, Obszönität, Pornografie zu tun hat. Nicht immer lässt sich der neutrale Blickwinkel der Wissenschaftlerin durchhalten.

Es wird schwierig sein, einen Schlusspunkt unter meine Arbeit zu setzen.
Mareike Meis
Eine Frage, die Mareike Meis im Rahmen ihrer Arbeit noch beantworten will, ist die nach den Auswirkungen solcher Videos auf Betroffene der Konflikte. Dazu plant sie Gespräche mit Künstlern, die mit den Videos arbeiten und teils Helfer in den Krisengebieten haben, die vor Ort filmen. Über diese Akteure hofft sie auch in Kontakt zu weiteren Konfliktbetroffenen treten zu können, die zurzeit in Deutschland im Asyl sind.
„In der gegenwärtigen Situation kann ich nicht nach Syrien fahren, das Risiko ist viel zu groß“, schildert sie das Problem. Zudem gibt es große Vorbehalte und Misstrauen auf Seiten der Betroffenen, mit denen sie bereits versuchte, in Kontakt zu treten. Mit ihren Gesprächspartnern will sie keine Interviews führen, sondern in einen Dialog treten, der offen und anthropologisch sein soll, und in den sie sich auch selbst einbringen will.
Wie nehmen die Konfliktbetroffenen die Videos wahr? Welche Rolle spielen die Videos? Wie war es vor Ort und wie ist es jetzt, die Aufnahmen zu sehen? Wie finden die Betroffenen den hiesigen Umgang mit den Videos und den Themen im Allgemeinen? Darüber hinaus interessiert Mareike Meis, wie die Videos eingesetzt und möglicherweise instrumentalisiert werden. Inwiefern dienen sie der Machtausübung? „Es wird schwierig sein, einen Schlusspunkt unter meine Arbeit zu setzen, weil ja immer mehr solcher Videos hochgeladen werden“, sagt die Forscherin. „Aber diese Schwierigkeit zu haben ist wohl allen medienästhetischen Themen gemeinsam.“