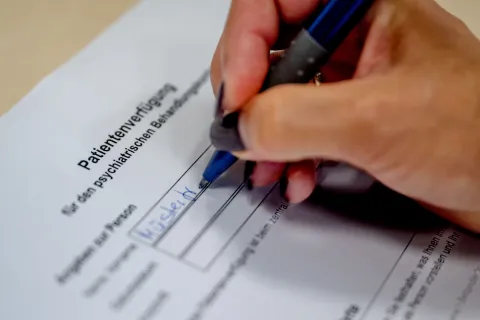Der Alu-Hut tauchte erstmals in einem Science-Fiction-Werk von Aldous Huxleys Bruder auf. Der Hut sollte vor gefährlicher Strahlung schützen. Heute verbindet man damit paranoides Verschwörungsdenken.
Sozialpsychologie
Die Verlockung der geheimen Mächte
Verschwörungsvorstellungen existieren seit Jahrhunderten. Warum sie Menschen in den Bann ziehen, welche Ideen ihnen zugrunde liegen und wie man als Gesellschaft wirkmächtig bleibt, verrät Florian Hessel im Interview.
Die Erde ist eine Scheibe. Den Klimawandel gibt es nicht. Das Corona-Virus übrigens auch nicht. Die Mondlandung hat nie stattgefunden. Und 9/11 war ein Inside-Job. Aber pssst! Nur Eingeweihte wissen um dieses Geheimnis. Und damit sind wir schon beim Kern und Grundmuster von Verschwörungsvorstellungen. Und beim Forschungsgebiet von Florian Hessel. Der Sozialwissenschaftler hat ihr Aufkommen ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt.
Herr Hessel, man wird den Eindruck nicht los, dass Verschwörungsvorstellungen gerade Hochkonjunktur haben. Wie erklären Sie sich die Verbreitung?
Florian Hessel: Verschwörungsideen haben definitiv Konjunkturen. Insbesondere in den Jahren der Covid-Pandemie konnte man, sozusagen unter Laborbedingungen, beobachten, wie bestimmte Themen – Impfkritik oder alternative Medizin – an Dynamik gewinnen und sich verbreiten. Die Rezeption in der politischen Öffentlichkeit sorgte für eine zusätzliche Mobilisierung und diese Erfahrung einer sichtbaren Gemeinschaft Gleichgesinnter wiederum für eine Enthemmung. Sobald das Krisenempfinden abnahm, ging auch der Auftrieb der Vorstellungen in der breiteren Öffentlichkeit wieder zurück. Die Konjunktur ist also auch eine Frage der Aufmerksamkeit.
Was ist denn der Kern von Verschwörungsvorstellungen? Und hat es die eigentlich schon immer gegeben?
Allen heutigen Verschwörungsvorstellungen liegt die Idee zu Grunde, dass es verborgene, unheimliche, übermächtige Personen oder Personengruppen gibt, die bestimmte Ereignisse oder auch eine Gesellschaft, also Politik, Ökonomie, Kultur und Medien, vielleicht sogar die ganze Welt, hintergründig beeinflussen, manipulieren oder gar vollständig kontrollieren.

„Mich interessiert nicht, welche Sau gerade durchs Dorf getrieben wird. Ich schaue mir die grundlegenden Muster der Vorstellungen an – und die ähneln sich im Großen und Ganzen“, sagt Florian Hessel, der zu Verschwörungsvorstellungen forscht.
Es gibt in der Öffentlichkeit und auch in der Wissenschaft immer wieder das Verständnis, sogenannte Verschwörungstheorien habe es schon immer gegeben. Vor einigen Jahren glaubten manche sogar, so etwas wie eine anthropologische Konstante diagnostizieren zu können. Diese Theorie, dass der Mensch sozusagen von Natur aus Verschwörungstheoretiker sei, ist allerdings heute nicht mehr en vogue. Und in ihrer so popularisierten Variante widerspreche ich ihr ausdrücklich. Verschwörungsdenken ist kein, sagen wir, allgemein menschliches, sondern ein gesellschaftlich modernes Phänomen.
Wann tauchen solche Vorstellungen zum ersten Mal auf?
Verschwörungsvorstellungen kann man bis an den Beginn des langen 19. Jahrhunderts, also in den Zeitraum um die industrielle Revolution in Großbritannien und die Französische Revolution zurückverfolgen. Diese sogenannte Doppelrevolution führte zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, in Frankreich etwa zur Ablösung des Adels und des Klerus und zur Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft. Vorher gab es hier eine klare Trennung: Politische Herrschaft war an einen Stand, also an konkrete Personen mit exklusiven Machtansprüchen, gebunden.

Das bereitete den Erfahrungsraum für die Idee einer Verschwörung, die die Gesellschaft als Ganzes kontrolliert.
Das hieß im Umkehrschluss auch, dass der größte Teil der Menschen keinen Anteil an der Politik hatte. Die Vorstellung von Gesellschaft als zusammenhängendes Ganzes konnte erst mit der Ablösung der Stände und der Etablierung kapitalistischer Produktionsweisen entstehen. Und das wiederum bereitete den Erfahrungsraum für die Idee einer Verschwörung, die die Gesellschaft als Ganzes kontrolliert.
Für welche konkrete Verschwörungsvorstellung bereitete die Revolution in Frankreich den Raum?
Namentlich für die sogenannte Illuminaten- und Freimaurerverschwörung. Diese Verschwörungsidee geht zurück auf den Jesuiten Augustin Barruel, der im Umfeld der Französischen Revolution die These verfocht, dass die Revolution und überhaupt alle gesellschaftlichen Veränderungen seiner Zeit das Ergebnis einer Verschwörung der Freimaurer mit den Jakobinern, also der radikalsten Fraktion der Französischen Revolution, seien.
Geheimbund Freimaurer/Illuminaten
Geheimbund Freimaurer/Illuminaten
Dieser Mythos war vor allem ein Propagandainstrument der Gegenrevolution, mit der man den Wandel erklärte und denunzierte.
Welchen Einfluss hatten diese Theorien auf spätere Verschwörungsvorstellungen?
Diese Verschwörungsmythen schufen einen bestimmten Traditionsbestand, der über das 19. Jahrhundert hinweg fortgeschrieben und unterschiedlich ausdifferenziert wurde. „Die Verschwörung“ wurde zu einem Motiv der entstehenden Massenkultur und Massenpolitik. In den USA verbreitete sich etwa im Kontext der Jacksonian Democrats die Vorstellung, dass die weltlichen Freimaurer sich – ironischerweise – mit den erzkatholischen Habsburgern verschworen hätten, um die Vereinigten Staaten zu zerstören. Es gab sogar eine Partei mit dieser Programmatik.
Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren
Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde dann das Konstrukt der jüdischen Weltverschwörung erfunden, wonach „die Juden“ beschuldigt wurden, sich gegen den Rest der Gesellschaft verschworen zu haben und nach Weltherrschaft zu streben. Mit diesem antisemitischen Mythos legitimierten die Nazis in ihrer Propaganda später den Holocaust und einen tatsächlichen Griff nach der Weltmacht.
Was zeichnet Verschwörungsvorstellungen heute aus?
Neu ist heutzutage die Geschwindigkeit, mit der auf überlappende Krisen reagiert wird und in der sich Themen und Deutungsmuster heute global verbreiten können. Die digitalen sozialen Medien spielen dafür eine große Rolle.
Gegenüber den geschlossenen Welterklärungsmodellen des 19. Jahrhunderts beobachten wir heute außerdem flexiblere, mit Antisemitismus, Fremdenhass oder Antifeminismus angereicherte Konglomerate an Verschwörungsideen, denen ein grundlegend autoritärer, antidemokratischer Modus gemein ist.
Wie erklären Sie sich deren Anziehungskraft?
Politische Entscheidungsprozesse, Herrschaft schlechthin, werden in unserer modernen, kapitalistischen, bürgerlichen Gesellschaft zunehmend abstrakt und entpersonalisiert. Es entstehen Bereiche, die in ihren Verfahren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich oder zumindest nicht ohne Weiteres einsichtig sind. Und genau an diesem Punkt, an diesem Widerspruch zwischen der entstehenden Öffentlichkeit und der strukturellen Notwendigkeit nicht-öffentlicher, zum Beispiel bürokratischer Verfahren, sitzen Verschwörungsvorstellungen auf.

Die Erklärung für negative Entwicklungen allein im Außen zu suchen und Verantwortung auf andere zu projizieren, ist sozialpsychologisch erklärbar.
Um gegen die Erfahrung gesellschaftlicher Ohnmacht etwas zu tun, projiziert man innerhalb von Verschwörungsvorstellungen den eigenen Wunsch nach Handlungs- und Kontrollmacht als absolute, unheimliche Übermacht auf eine reale oder imaginierte Gruppe, die angeblichen Verschwörer. Diese Neigung, die Erklärung für negative Entwicklungen allein im Außen zu suchen und Verantwortung auf andere zu projizieren, ist sozialpsychologisch erklärbar. Dieser Mechanismus der Projektion ist uns allen vertraut und letztlich Teil unserer Sozialisation.
Was folgt nun daraus für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft?
Das zentrale Problem ist nicht, dass es Einzelne gibt, die an Verschwörungen glauben oder diese verfechten, sondern dass heute mehr und mehr Menschen den Glauben an eine kollektive, solidarische gesellschaftliche Wirksamkeit verloren haben.

Verschwörungsvorstellungen sind immer ein Symptom eines bestimmten gesellschaftlichen Zustands.
Verschwörungsvorstellungen sind immer ein Symptom eines bestimmten gesellschaftlichen Zustands und des politisch-kulturellen Klimas. Das bestätigte auch die neueste Leipziger Autoritarismus-Studie. Danach ist ein Drittel der Befragten bereit, Verschwörungen als Erklärungsmuster für Gesellschaft und Politik anzunehmen. Gleichzeitig wirken solche Verschwörungsvorstellungen wie ein Katalysator. Die Vehemenz, mit der sie verfochten werden, steigert ihre Wirkung und befördert ein verallgemeinertes Misstrauen.

Moderne Verschwörungsvorstellungen greifen die Grundfesten unserer Demokratie an.
Kompromisse zu finden, Interessen auszugleichen, Widersprüche auszuhalten, das Gegenüber überhaupt als Gesprächspartner*in anzuerkennen, wird schwierig bis unmöglich. Und genau das sind ja die Grundlagen einer funktionierenden pluralistischen, liberalen Demokratie. Moderne Verschwörungsvorstellungen greifen die Grundfesten unserer Demokratie an. Ihr antidemokratischer Modus geht mit einer totalitären Logik von Politik einher, mit der Schaffung von absoluten Feindbildern, von Opfern der Verschwörung auf der einen Seite und Verschwörern auf der anderen, von Gut und Böse, Licht und Finsternis.
Was tun gegen antidemokratische Verschwörungsvorstellungen?
Man muss auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Mit Bildung und Aufklärung in Schulen, an Universitäten und in der Gesellschaft allein ist es nicht getan, weil es eben nicht – zumindest nicht nur – um rational begründbare Interessen, sondern um Emotionen und Affekte geht, um autoritäre Sehnsüchte, um den Wunsch, sich angesichts globaler Unübersichtlichkeit durchsetzen zu können, kompromisslos wirkmächtig zu sein. Man muss ansetzen, wo und wie Menschen sozialisiert werden. Es muss (wieder) gelernt werden, dass man Widersprüche aushalten kann, dass es auch andere Interessen geben kann, die legitim sind und die dem eigenen Interesse entgegenstehen dürfen.

Man muss diejenigen stärken, die sich gegen Ressentiments wie Antisemitismus und Rassismus positionieren.
Dazu müssen ganz grundlegend gesamtgesellschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit auch wieder auf einer politischen oder politisch-ökonomischen Ebene verankert werden. Und man muss diejenigen stärken, die sich gegen Ressentiments wie Antisemitismus und Rassismus positionieren.

Was tun gegen antidemokratische Verschwörungsideen? Gegen rechtes und antidemokratisches Gedankengut gingen zuletzt deutschlandweit Tausende auf die Straßen – auch in Bochum.
Es ist ganz konkret nicht geholfen, wenn Vertreter*innen der sogenannten bürgerlichen Mitte, aber auch teilweise der politischen Linken, in der Öffentlichkeit auf autoritäre Sehnsüchte anspielen, Themen der extremen Rechten aufnehmen, zu populistischen Formulierungen oder Mechanismen greifen, die man aus Verschwörungsvorstellungen kennt, um in der politischen Auseinandersetzung und im Wahlkampf gegen andere demokratische Parteien und die engagierte Zivilgesellschaft zu agitieren.
Bieten Verschwörungsvorstellungen vielleicht auch eine bequemere Zuflucht?
Autoritäre Strukturen und Versprechen sind bequem, weil ich mich der eigenen Verantwortung entledigen kann. Man unterwirft sich einer bestimmten Idee, Vorstellung, einer Person oder Partei. Die regelt das dann für einen und man muss selbst nichts mehr tun, kann reagieren statt selbst denken, darf gar dem Ressentiment freien Lauf lassen.

Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss.
In liberalen Demokratien – und das ist zugleich ihr Vorteil und Nachteil – gibt es diese Gewissheit von Eindeutigkeit, von Geschlossenheit, von absoluter Beherrschbarkeit nicht. Sie bleibt eine Herausforderung, ein Ort der Vieldeutigkeit, der Offenheit, aber eben auch der Abhängigkeit und der Fremdbestimmung. „Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss“ – so formulierte es der vor einem Jahr leider verstorbene Soziologe Oskar Negt.
Blicken Sie mit Sorge oder mit Zuversicht auf die kommenden Jahre?
Ich glaube fest daran, dass Menschen grundsätzlich vernunftfähig sind und daran, dass die Gesellschaft von Menschen bewusst zu etwas Besserem verändert werden kann. Wir sehen Tendenzen, die die Hoffnung darauf nicht ganz aufgeben lassen. Denken wir etwa an die vielen Menschen, die gegen die AfD und den sogenannten Rechtsruck auf die Straße gehen.

Das hilft gegen das allgegenwärtige Ohnmachtsgefühl: Selbstwirksam werden, Gleichgesinnte treffen, sich gemeinsam für demokratische Werte und gesellschaftliche Wirksamkeit engagieren.
Der Blick auf den Zustand der Welt und die Erfahrung der Geschichte des 20. Jahrhunderts lädt sicher nicht zu großem, gar ungebrochenem Optimismus ein. Es lohnt sich aber umso mehr, sich für solidarische gesellschaftliche Wirksamkeit und Teilhabe einzusetzen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, im sozialen oder im politischen Bereich, im privaten oder beruflichen Umfeld. All das ist möglich – und sehr notwendig.