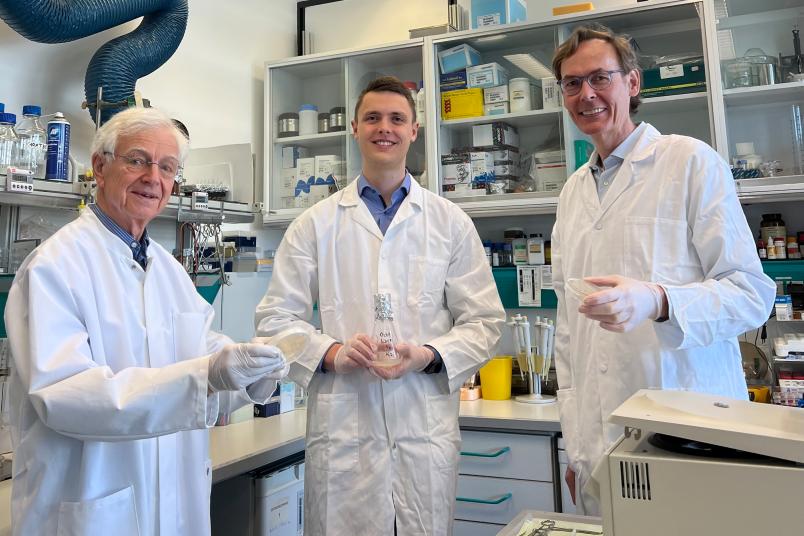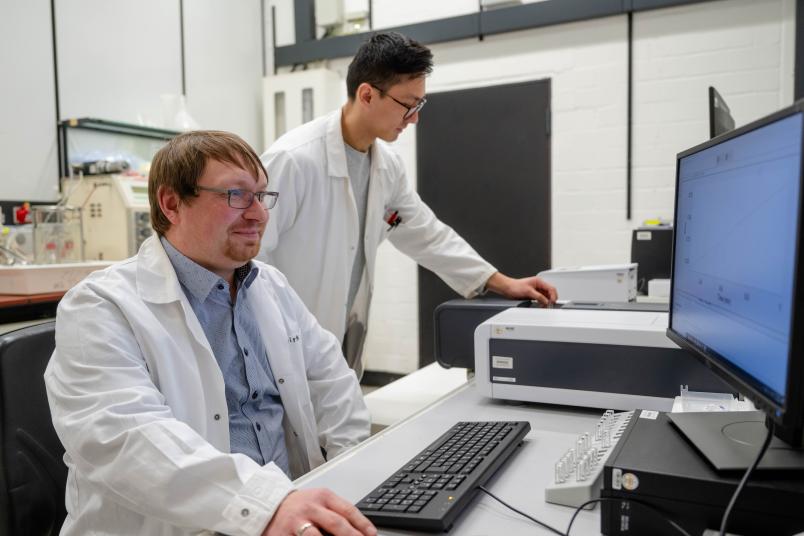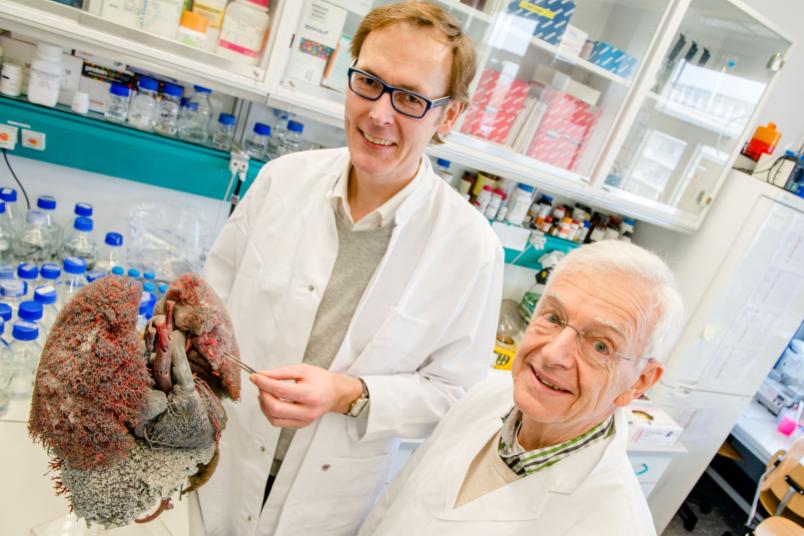
Medizin Neue Form von Gefäßverschluss entdeckt
Wie DNA im Blut krank macht – und was eine geeignete Therapie wäre.
Das Fehlen von DNA-abbauenden Enzymen im Blut kann unter bestimmten Bedingungen zum Verschluss winziger Blutgefäße und somit zum Tod führen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam mit RUB-Beteiligung in der Top-Zeitschrift „Science“.
DNA-Fangnetze gegen Bakterien
DNA gelangt in manchen Situationen durch das Immunsystem ins Blut. Wird der Körper mit extrem vielen Bakterien überschwemmt, stoßen die weißen Blutkörperchen ihre Zellkerne aus. Die darin enthaltene DNA bildet zusammen mit Proteinen ein Fangnetz, das die Bakterien neutralisiert. Nach erfolgreicher Immunabwehr bauen Enzyme die DNA im Blut ab. Zwei solcher Enzyme wurden bereits identifiziert, genannt DNase1 und DNase1l3.
„Wir haben schon länger vermutet, dass das Freisetzen von DNA im Blut krank machen kann und dass die Enzyme das normalerweise verhindern“, sagt Dr. Markus Napirei aus der Abteilung für Anatomie und Molekulare Embryologie der RUB, einer der Autoren der Science-Studie. Er und der emeritierte Professor Dr. Hans Georg Mannherz, ebenfalls Autor von der RUB, gingen dieser Theorie auf den Grund, gemeinsam mit Kollegen aus Tokyo und vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Verklumpte Netze verstopfen Gefäße
Das Team untersuchte Mäuse mit zwei Genmutationen, die bewirken, dass die Tiere beide DNA-abbauenden Enzyme nicht herstellen konnten. Einmal gebildete DNA-Fangnetze konnten somit nicht wieder abgebaut werden und lagerten sich stattdessen zusammen. Das führte zum Verschluss kleinster Blutgefäße im Körper, der in der Regel tödlich war. Führten die Forscher jedoch eines der beiden Enzyme zu, DNase1 oder DNase1l3, verhinderte das die Ansammlung der Netze und somit auch den Gefäßverschluss.

Die durch die DNA-Netze ausgelösten Verschlüsse erfordern eine alternative Therapie.
Markus Napirei und Hans Georg Mannherz
Klinisch arbeitende Kooperationspartner der Forscher lieferten Hinweise, dass es auch bei bestimmten Krankheiten des Menschen, zum Beispiel bei bakterieller Blutvergiftung, zu DNA-Netz-Aggregaten kommen kann. „Die Daten zeigen also, dass es neben dem bekannten Aderverschluss durch Thrombose, der durch das Protein Fibrin und durch Blutplättchen verursacht wird, noch eine bislang unbekannte Form des Gefäßverschlusses gibt, insbesondere kleiner Gefäße“, erklären Napirei und Mannherz. „Die durch die DNA-Netze ausgelösten Verschlüsse erfordern eine alternative Therapie, zum Beispiel ein Auflösen durch DNA-abbauende Enzyme.“
Die Studie ist unter Federführung des Teams um Dr. Tobias Fuchs vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erschienen.