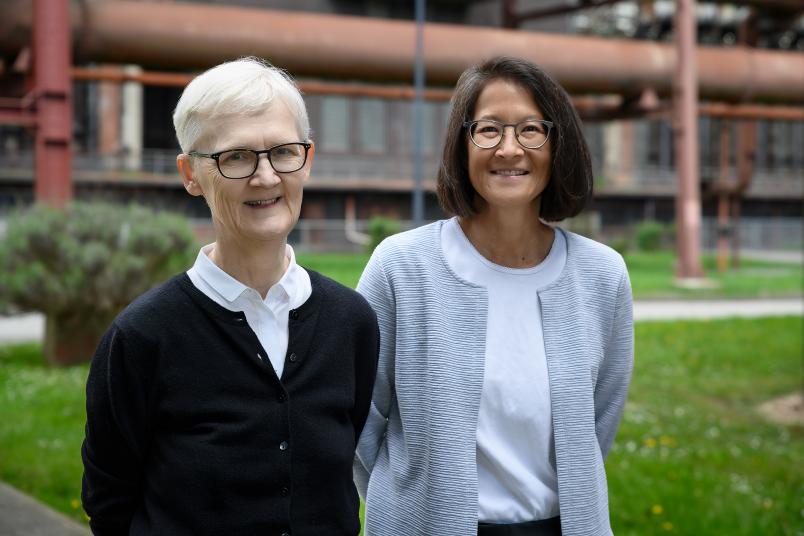Neurowissenschaft Forscher beobachten Lernprozesse im Gehirn
Verabreicht man über lange Zeit einen Tastreiz immer wieder, verändert sich die Aktivität der für die Verarbeitung zuständigen Nervenzellen.
Reizt man über längere Zeit die Fingerspitze mit einem wiederholten Tastimpuls, verbessert sich der Tastsinn nachweislich. Was dabei im Gehirn passiert, hat ein Forschungsteam um Privatdozent Dr. Hubert Dinse an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) untersucht. Die Forscher registrierten mithilfe eines Enzephalogramms (EEG) die Aktivität von Nervenzellen der für die Verarbeitung zuständigen Hirnbereiche. Dabei konnten sie beobachten, dass sich die Aktivität der dortigen Nervenzellen verändert – möglicherweise ein Abbild eines Lernprozesses. Das Team berichtet in der Zeitschrift Frontiers in Human Neuroscience vom 30. Juni 2020.
Lernen durch Wiederholung
Normalerweise lernen Menschen durch Übung und Wiederholung, wodurch im Gehirn ein Prozess angeregt wird, der sich neuronale Plastizität nennt. Eine zelluläre Basis für solche Plastizitätsprozesse besteht in der Langzeitpotenzierung, einer Fähigkeit von Gehirnzellen, die Kommunikationsstärke zwischen einzelnen Nervenzellen zu verbessern.
An diese Langzeitpotenzierung angelehnt hat das Forschungsteam stimulationsbasierte Lernmethoden entwickelt. Dabei werden Sinne, beispielweise der Seh- oder Tastsinn, rhythmisch stimuliert. Ein gut untersuchtes Beispiel dafür ist die elektrische Stimulation der Fingerspitzen, die – wenn sie mit der richtigen Frequenz angewandt wird – die Tastfähigkeit der Finger nachweislich erhöhen kann. Studien zeigen, dass diese Stimulation der Fingerspitzen zu bedeutenden Plastizitätsprozessen im somatosensorischen Cortex führt. Ob dabei allerdings auch tatsächlich Langzeitpotenzierung stattfindet, ist noch nicht bewiesen.
Zwei Gruppen, zwei Experimente
Die Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der RUB haben daher stimulationsbasiertes Lernen bei Freiwilligen mittels Elektroenzephalografie untersucht. Dabei wollten sie die Aktivität der Nervenzellen während eines Lernprozesses sichtbar machen. Sie führten zwei Experimente mit zwei Gruppen von Probanden durch. Das erste Experiment diente lediglich der Absicherung, dass die in diesem Versuch verwandte Methode der Stimulation mit pulsierenden Luftkissen denselben steigernden Effekt auf das Tastempfinden hat wie die etablierte Methode der elektrischen Stimulation. Die elektrische Variante konnte in diesem Fall nicht zum Einsatz kommen, da sie das Signal der EEG-Aufnahme gestört hätte.
Im zweiten Experiment erhielten die Freiwilligen 40 Minuten lang eine schmerzfreie Stimulation des Fingers mit den Luftkissen. Gleichzeitig wurde durch das EEG die Aktivität im somatosensorischen Cortex der Probanden gemessen. Dabei konzentrierten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Bereich dieses Hirnareals, in dem die Signale aus der rechten Hand verarbeitet werden.
Nervenzellen passen ihre Aktivität an
„Durch die elektrophysiologischen Messungen der Gehirnaktivität konnten wir zeigen, dass zu aktiven Stimulationsphasen große Zellensembles ihre Aktivität an die Frequenz der Stimulation anpassen. Diese Reaktion bleibt über 20 Minuten hinweg konstant, ohne Zeichen von Gewöhnung, ganz ähnlich wie bei zellulärer Langzeitpotenzierung“, erklärt Dr. Marion Brickwedde, Erstautorin der Studie.
Weiterhin konnten die Forscherinnen und Forscher aber auch beobachten, wie sich die neuronale Reaktion auf die Stimulation über die Zeit hinweg veränderte. Sie stellten fest, dass sich die Form der ereigniskorrelierten Potenziale veränderte, welche Verarbeitungsprozesse im Gehirn darstellen. Auch die ereigniskorrelierte Desynchronisierung des Alpha-Rhythmus, eine typische Reaktion auf Tastreize, ist nach 20 Minuten verringert.
„Diese Prozesse stellen möglicherweise Veränderungen in der Verarbeitungsbereitschaft taktiler Gehirnareale dar, also einen direkt beobachtbaren Lernprozess. Ob die hier eingesetzte Fingerstimulation tatsächlich Langzeitpotenzierung im menschlichen sensomotorischen Cortex auslöst, lässt sich noch nicht endgültig klären. Berücksichtigt man aber frühere Forschungsergebnisse, die beispielsweise die Abhängigkeit beider Prozesse vom gleichen neuronalen Rezeptortyp zeigen, spricht viel dafür“, erklärt Marion Brickwedde.