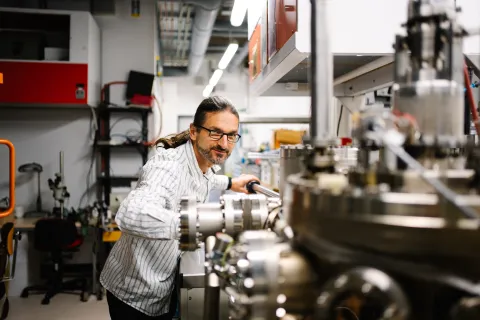Das IceCube-Labor befindet sich in der Nähe der Amundsen-Scott South Pole Station in der Antarktiks. Hier befinden sich zum Beispiel die Computer, die die Daten aufzeichnen.
Kosmische Strahlung
Neutrino-Flugbahnen in Echtzeit detektieren
Mithilfe von Neutrinos wollen Forschende die Quellen der kosmischen Strahlung finden. Neue Algorithmen aus Bochum helfen bei der Suche. Sie haben aber auch ein paar aussichtsreiche Kandidaten aus dem Rennen geworfen.
Mit dem Neutrino-Detektor IceCube am Südpol sucht ein internationales Forschungsteam seit 2009 nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung. Neue Algorithmen der Bochumer Gruppe um Prof. Dr. Anna Franckowiak erhöhen die Chance auf Entdeckungen. Mit ihnen lassen sich in Echtzeit Energie und Richtung der von IceCube gemessenen Teilchen bestimmen, sodass Teleskope weltweit auf die Suche nach ihren Absendern gehen können. Mit den neuen Algorithmen wertet das Team auch Archivdaten noch einmal aus – und musste jüngst einige Kandidaten für die Quellen der kosmischen Strahlung verwerfen. Über die Arbeit berichtet das Wissenschaftsmagazin Rubin der Ruhr-Universität Bochum.
Die kosmische Strahlung prasselt unaufhörlich auf die Erde ein, in Form von verschiedenen Teilchen wie Elektronen, Protonen oder Neutrinos. Wo sie herkommt, ist ungewiss. Neutrinos können Raum und Materie über riesige Distanzen durchdringen, ohne zu wechselwirken. Das macht sie zu den idealen Kandidaten, um nach den Quellen der kosmischen Strahlung zu suchen, weil sie auf mehr oder weniger direktem Weg von ihrem Ursprung aus zur Erde fliegen. Dort können sie vom IceCube-Detektor aufgespürt werden.
Neutrino-Richtungen schnell und präzise bestimmen
Der Algorithmus für die Analyse der Neutrino-Flugbahn von Anna Franckowiaks Team funktioniert präzise und schnell. „Wir brauchen 30 Sekunden, um die Energie und Richtung eines Neutrinos zu berechnen, und verbreiten die Information umgehend weltweit“, erklärt die Leiterin der Arbeitsgruppe für Multi-Wellenlängen- und Multi-Messenger-Astronomie, die auch Mitglied des in Bochum koordinierten Sonderforschungsbereichs Cosmic Interacting Matter ist.
Mit einem langsameren Algorithmus verfeinert Franckowiaks Team anschließend das erste schnelle Ergebnis und gibt ein Update zur ursprünglichen Neutrino-Meldung heraus. Vier- bis fünfmal präziser klappt die Richtungsbestimmung mittlerweile im Vergleich zu früheren Verfahren.
Anhand der Daten durchforsten Teleskope auf der ganzen Welt dann die Himmelsregion, aus der das Neutrino kam, nach einem besonders energiereichen Objekt, das der Absender des Teilchens gewesen sein könnte. „Es ist möglich, dass diese Himmelsobjekte nur kurz aufleuchten, daher ist es so wichtig, dass unser System in Echtzeit funktioniert“, sagt Anna Franckowiak.
Doch keine Quellen
Ist eine potenzielle Quelle für das Neutrino gefunden, geht die Rechnerei wieder los. „Dann ermitteln wir, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir – wenn wir in diese Richtung des Himmels schauen – zufällig ein solches Himmelsobjekt aufleuchten sehen, das nichts mit dem Neutrino zu tun hat“, so Franckowiak. Zwischenzeitlich hatten die Forschenden sogenannte Gezeitenkatastrophen als Neutrino-Quellen in Betracht gezogen. „Sie entstehen, wenn ein Stern zu nah an ein inaktives Schwarzes Loch gerät, das zwar gerade keine Materie schluckt, den Stern aber mit seiner großen Gravitation in die Länge zieht und zerreißt“, erklärt die Physikerin.
Drei Neutrino-Ereignisse hatte IceCube im Lauf der Jahre entdeckt, die potenziell mit Gezeitenkatastrophen in Zusammenhang gebracht wurden. Aber: „Nachdem wir unseren Algorithmus für die Richtungsrekonstruktion verbessert hatten, haben wir die Ereignisse noch einmal analysiert – und die Flugbahn der Neutrinos passt nicht zu den Positionen, an denen die Gezeitenkatastrophen stattgefunden haben“, resümiert Anna Franckowiak.
Ausführlicher Artikel im Wissenschaftsmagazin Rubin
Originalveröffentlichungen