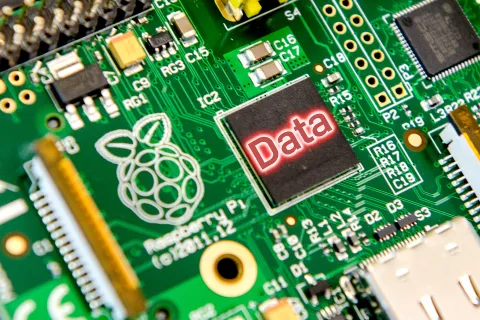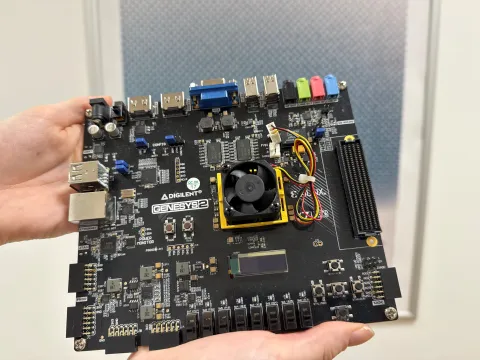Legende
Der Mythos vom Hafen des Wissens
Gebäude wie Ozeandampfer und eine Muschel als Audimax: Waren diese Bilder wirklich von Anfang an geplant? Eine Architekturhistorikerin klärt auf.
Die Ruhr-Universität Bochum besticht nicht nur durch ihre einmalige Lage am Lottental, sie ist auch architektonisch ein Hingucker. Seit die Lehr- und Forschungsarbeit im Jahr 1965 begonnen hat, lösten die Fakultätsgebäude ein Bild aus, das bis heute in den Köpfen der Menschen verankert ist: die RUB als Hafen des Wissens. Der Bochumer Theologe Prof. Dr. Erich Gräßner wurde noch im Jahr der Einweihung vom Spiegel zitiert, dass die Gebäude der RUB wie „Ozeanriesen ohne Heck und Bug“ aussehen.
In der Tat erscheint dieser Vergleich passend. Die hoch aufragenden Fassaden der länglichen Fakultätsgebäude muten unweigerlich wie Kreuzfahrtdampfer an. Die Geländer der Balkone ziehen sich um die Außenseiten wie die Reling eines Schiffes. In manchen Fassaden sind Bullaugenfenster eingebracht, und von einigen Dächern ragen runde Schornsteine empor. Das macht das Bild eines Schiffes scheinbar perfekt. Doch dienten wirklich Schiffe als Vorlage für die RUB-Gebäude?
„Leider gibt es keinen verlässlichen Beweis dafür, dass sich die Architekten die Hafenmetaphorik bereits im Entwurf so gedacht haben“, erklärt Dr. Alexandra Apfelbaum. Und sie muss es wissen. Als Architekturhistorikerin beschäftigt sie sich intensiv mit Nachkriegsarchitektur. So untersuchte sie für ihre Promotion das Wirken von Bruno Lambart, der die Universitätsbibliothek und die alte Mensa an der RUB realisiert hatte.
„Das Schiffsmotiv drängt sich unweigerlich durch die schiere Dimension der Gebäude auf“, so Apfelbaum. „Es ist aber nicht in der Grundidee verankert, sondern erst im Nachhinein so interpretiert worden. Das gilt auch für später hineingedeutete Bilder, wie dass das Audimax an das Aussehen einer großen Muschel angelehnt sei“, erklärt sie.
Trotzdem findet Apfelbaum die nachträglich interpretierte Hafensymbolik nicht negativ: „Wenn irgendein gewiefter Journalist das so formuliert und sich das dann in Architekturbeschreibungen immer weiterträgt, ist es völlig in Ordnung.“
Bollwerk der Bildung
Doch welcher Gedanke steckt nun wirklich hinter dem Design der elf Fakultätsgebäude? „Sie erinnern eher an Verwaltungsbauten oder Bürogebäude als an Hochschulbauten“, sagt Apfelbaum. Das Design sei vielleicht als Zeichen für den sich anbahnenden Strukturwandel geplant gewesen: weg von der Zechenstadt hin zu einem Bollwerk der Bildung. „Dabei spielte der demokratische Gedanke eine entscheidende Rolle“, so die Architekturhistorikerin.
Denkmalschutz
Statt Hafenmetaphorik war den Architekten vor allem Einheit wichtig. „Die Juristen sitzen in einem gleichartigen Gebäude wie die Kunstwissenschaftler, die Mediziner und die Naturwissenschaftler. Es gibt keine baulichen Unterschiede, die einen Fachbereich besonders hervorheben. Alle sind gleichberechtigt“, erklärt Apfelbaum.
Das Pendant zu dieser Einheit stellt die Zentralachse des Campus dar. Dort sind die zentralen Einrichtungen untergebracht, alle individuell gestaltet, um sie optisch hervorzuheben. Schließlich sind diese Gebäude wie Audimax, Mensa und Universitätsbibliothek für jeden an der Universität wichtig, was die besondere Architektur betont.
Betonwunder im Grünen
Ein umstrittenes Hauptmerkmal der RUB-Architektur ist die allgegenwärtige Präsenz von Beton. Während sie einigen missfällt, ist es gerade das, was Alexandra Apfelbaum so begeistert. „Besonders dieser reizvolle Kontrast zwischen dem rauen, verwitterten Beton und dem vielen Grün hat einen ganz eigenen Charme“, schwärmt sie.
Zur Person
Originalveröffentlichung