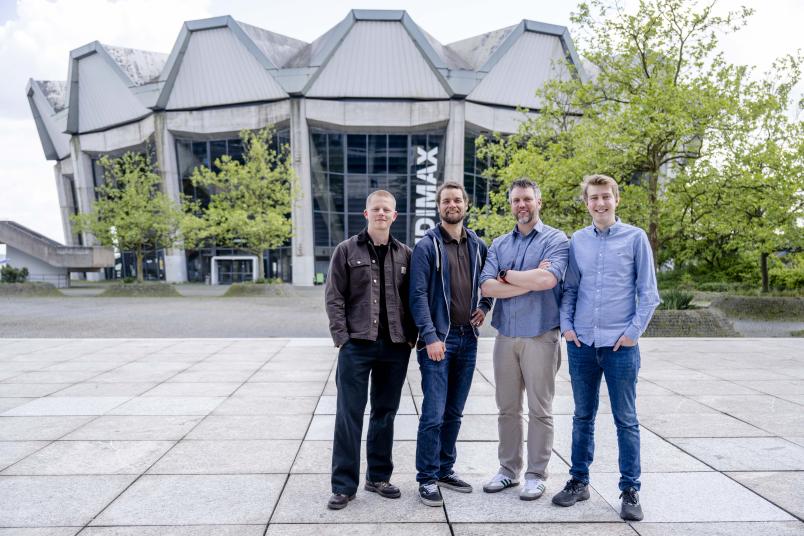Geologie
Was Kristalle über Vulkanausbrüche verraten
Mit dieser Methode können Forscher Jahrtausende in die Vergangenheit schauen.
Vor 4.000 Jahren hat der indonesische Vulkan Mount Gede bei einem Ausbruch zahlreiche Kristalle ausgespien. In ihnen verborgen sind Hinweise auf das, was vor dem Ausbruch in der Magmakammer vorging. Mit einer an der RUB etablierten Methode lassen sich die Geheimnisse lüften. Die internationale wissenschaftliche Top-Zeitschrift „Science“ hat dem Verfahren in der Ausgabe vom 18. November einen Feature-Artikel gewidmet.
Anhand der Mineralverteilung in Vulkankristallen untersuchten Prof. Dr. Fidel Costa und sein Doktorand die Prozesse im Inneren des Mount Gede vor 4.000 Jahren. Sie fanden zum Beispiel heraus, dass vier Wochen vor dem Ausbruch frisches Magma in die Kammer unter dem Vulkan geströmt war. Die bei den Analysen angewandte Methode lernte Costa an der RUB kennen, wo er zwischen 2002 und 2006 als Postdoktorand arbeitete. Heute ist er am Earth Observatory in Singapur tätig.
Wachstumsringe wie in Bäumen
Costa forschte im Bochumer Team von Prof. Dr. Sumit Chakraborty, der den Lehrstuhl für Mineralogie und Petrologie leitet. Er gilt als Pionier auf dem Gebiet der sogenannten Diffusions-Chronometrie. Das RUB-Team bietet regelmäßig Workshops an, um Forscher aus aller Welt in der Methode zu schulen.
Mit dem Verfahren analysieren Wissenschaftler Kristalle, die sich in Magmakammern bilden. Die Kristalle sind nicht gleichförmig aufgebaut, sondern besitzen ringförmige Zonen mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen – ähnlich den Jahresringen von Bäumen. Wie viel von welchen chemischen Elementen in einer Kristallzone vorkommen, ist abhängig von der Zusammensetzung des umgebenden Magmas sowie von Umgebungsvariablen wie Druck und Temperatur.
Kristalle als Uhren
Kommt ein neuer Schwall Magma in der Kammer unter dem Vulkan an, kann ein neuer Wachstumsring entstehen, der chemisch anders als der vorherige ist. Zunächst entsteht eine scharfe Grenze zwischen den beiden Wachstumszonen. Aufgrund von Teilchenbewegungen im Kristall verschwimmt diese jedoch im Lauf der Zeit. Elemente aus dem einen Ring wandern langsam in den anderen und umgekehrt.
Bricht der Vulkan aus, hören die Teilchen auf zu wandern. Die Elementverteilung in den Kristallen wird quasi eingefroren. Auch nach Tausenden von Jahren können Forscher somit aus der chemischen Zusammensetzung der Kristalle Rückschlüsse auf Bedingungen in der Magmakammer ziehen. Je nachdem wie unscharf eine Grenze zwischen zwei Wachstumsringen ist, wissen sie sogar, wie lang der Kristall in der Kammer schwamm, bevor der Vulkan ausbrach.
Besonders interessant ist es für Forscher, wenn sie Daten der Diffusions-Chronometrie mit Aufzeichnungen von der Oberfläche zusammenbringen können, zum Beispiel seismischer Aktivität oder Gasfluss. Genau das tat die Bochumer Doktorandin Maren Kahl. Sie untersuchte Kristalle des italienischen Vulkans Etna, die bei acht verschiedenen Ausbrüchen zwischen 1991 und 2008 an die Oberfläche geschleudert worden waren. Der Etna ist einer der am besten erforschten Vulkane weltweit. Daher gab es reichhaltiges Datenmaterial, das bei den Ausbrüchen aufgezeichnet worden war.
Maren Kahl, inzwischen an der isländischen Universität in Reykjavik tätig, ordnete die Ergebnisse der Kristallanalyse den Aufzeichnungen von der Oberfläche zu. So wusste sie, welche Prozesse in der Tiefe des Vulkans – etwa ein Magmaschub – welche Signale an der Oberfläche – etwa seismische Aktivität – ausgelöst hatten. Aus ihren Analysen rekonstruierte sie erstmals ein detailliertes Modell der fünf Magmaumgebungen unterhalb des Etna und konnte sogar zeigen, wie diese zusammenspielen.