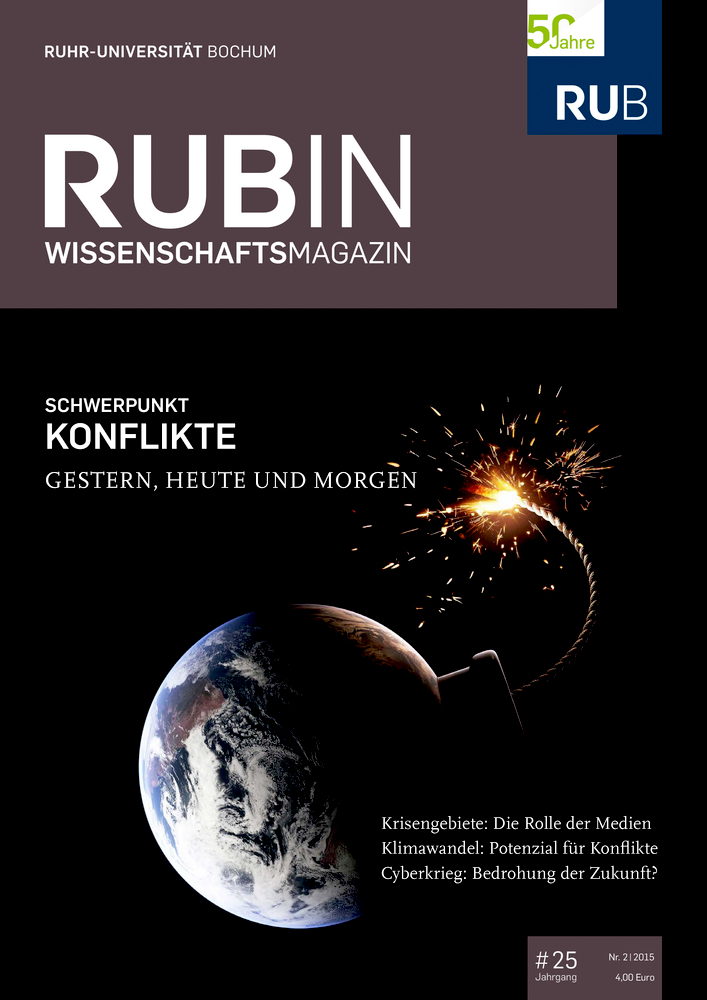Frustration statt Motivation
W-Besoldung verfehlt oft ihren Zweck
Mit der W-Besoldung wurden Bonuszahlungen für Professoren eingeführt. Das sollte für Motivation sorgen. Was die Maßnahme wirklich bewirkte.
Im Jahr 2002 erließ der Bund ein Gesetz, das die Besoldung von Professorinnen und Professoren auf eine neue Grundlage stellte. Im Gegensatz zur vorher geltenden C-Besoldung sollte die neue W-Besoldung für leistungsorientierte Gehälter sorgen. Der Gesetzgeber wollte besondere Verdienste von Hochschullehrern würdigen und neue Motivation für außergewöhnliche Leistungen schaffen.
Ob die Reform ihr Ziel erreicht hat, hat Sozialwissenschaftlerin Dr. Linda Jochheim während ihrer Promotion am Lehrstuhl für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik der RUB untersucht.

Seit 2005 neu berufene Professoren – oder solche, die freiwillig in die W-Besoldung gewechselt sind – erhalten ein niedrigeres Grundgehalt als ihre Kolleginnen und Kollegen im alten C-Besoldungssystem. Dafür können sie Zulagen für besondere Verdienste bekommen.
Linda Jochheim nennt ein paar Beispiele: „Man kann etwa einen Antrag stellen, wenn man besonders hochkarätig publiziert, innovative Lehrformate entwickelt oder besonders viele Drittmittel einwirbt.“ Aufschläge aufs Grundgehalt sind auch in Berufungs- oder Bleibeverhandlungen möglich oder wenn jemand eine bestimmte Funktion wahrnimmt, sich zum Beispiel als Prorektor oder Dekan engagiert.

Die Beteiligten nehmen das System als sehr intransparent wahr.
Linda Jochheim
Was genau man tun muss, um einen Bonus zu erhalten, ist aber in den Landesgesetzen größtenteils sehr allgemein gehalten; jede Universität kann ihre eigenen Maßstäbe anlegen. Ein Problem, wie Linda Jochheims Untersuchungen ergaben: „Die Beteiligten nehmen das System als sehr intransparent wahr“, sagt sie.
Ihre Schlussfolgerungen basieren dabei auf einer groß angelegten Fragebogenstudie, die sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Rahmen des Projekts „Wirkungen neuer Steuerung auf die Aktivitätsstruktur von Universitäten“ durchführte, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Im Jahr 2014 füllten 275 W-besoldete Professoren an allen 87 deutschen Universitäten einen Fragebogen zu den Effekten der W-Besoldung aus. Vertiefende Analysen stellte Linda Jochheim außerdem in sieben Fallstudien an, in denen sie mit einem Kollegen 40 Personen ausführlich interviewte.
Gute Idee, aber Probleme in der Umsetzung
Generell gilt: Sowohl Hochschulleitung also auch Professorinnen und Professoren begrüßen mehrheitlich die Idee hinter der W-Besoldung, sind also dafür, dass sich das Gehalt an der Leistung orientiert. Allerdings sieht der Großteil nicht, dass das in der Praxis tatsächlich geschieht. Denn es mangelt schlicht und ergreifend am Budget.
„Viele Universitäten brauchen einen Großteil ihres Personalbudgets für Berufungs- und Bleibeverhandlungen, also um die guten Leute überhaupt erst an die Uni zu bekommen oder sie zu halten“, erklärt Jochheim. „Dann bleibt kaum noch etwas übrig, um besondere Leistungen zu würdigen.“
So schilderten Angehörige einer Universität etwa, dass gerade einmal fünf Professoren pro Jahr eine Zulage für besondere Leistungen erhalten können, weil der Rest der Mittel für andere Zwecke ausgegeben wird. Bei rund tausend eingegangenen Anträgen erhält die überwiegende Mehrheit eine Absage. „In diesem Fall wussten die Professoren auch gar nicht, dass so wenige Anträge genehmigt werden konnten. Somit blieb für sie unklar, warum ihre Leistung nicht anerkannt wurde“, erzählt die Sozialwissenschaftlerin.
Geisteswissenschaftler benachteiligt
Das Resultat: Eher Frustration statt Motivation. 75 Prozent aller Befragten gaben in der Studie an, die W-Besoldung führe nicht zu einer verstärkten Würdigung ihrer Forschungsarbeit; sogar 92 Prozent sagten das über die Lehrtätigkeit. Eine große Mehrheit lehnte auch die Aussage ab, die W-Besoldung steigere die Qualität von Lehre und Forschung. Stattdessen empfanden es die Befragten als langwierig und zeitraubend, die Leistungszulagen zu beantragen.
Die Studie zeigte auch, dass Geisteswissenschaftler seltener beziehungsweise geringere Leistungszulagen erhalten als ihre Kollegen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Denn letztere haben bessere Marktchancen und somit auch eine bessere Verhandlungsposition. Trotzdem befürworten auch Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler prinzipiell die leistungsbezogene Bezahlung. Abhilfe schaffen könnten laut Linda Jochheim unterschiedliche Geldtöpfe für die Disziplinen.
Nachgebessertes Gesetz
Das Gesetz zur W-Besoldung musste bereits einmal nachgebessert werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht es 2012 für verfassungswidrig erklärt hatte. Durch das niedrige W2-Grundgehalt und die nur spärlich ausgezahlten Leistungszulagen verdienten Hochschullehrer teils weniger als Studienräte. Einige Professorinnen und Professoren erhielten nie die Chance, ihr Grundgehalt durch Zulagen aufzubessern, weil sie erst spät im Jahr berufen wurden und das Budget bereits ausgeschöpft war.
Was also taten die Bundesländer nach dem Urteil? Sie versuchten, das Gehaltsgefüge geradezurücken, indem sie das Grundgehalt anhoben. Bei den Professorinnen und Professoren, die Leistungszulagen erhielten, verrechneten sie die Erhöhung aber mit dem Bonus; sie kürzten ihnen also die Zulagen. Wer sich besonders verdient gemacht hatte, bekam also nicht mehr als vorher, während andere, die nicht durch besondere Leistungen aufgefallen waren, eine Gehaltserhöhung erhielten.
Verfassungswidriges System
Das Urteil hatte noch einen weiteren negativen Effekt: Durch die Anhebung des Grundgehalts war fortan noch weniger Geld in den Töpfen vorhanden, um leistungsbezogene Zulagen auszuzahlen. „Laut dem ‚Deutschen Hochschulverband‘ ist die Ausgestaltung der W-Besoldung nach wie vor verfassungswidrig. Er unterstützt bereits einen Musterprozess zur gerichtlichen Klärung der reformierten Besoldungsstruktur“, sagt Jochheim.
Selbst wenn die Klage Erfolg hat, wird sie den Hochschulen aber wohl kaum schlagartig mehr Budget bescheren. „Eine Möglichkeit, die Leute zu motivieren, könnten auch immaterielle Anreize sein“, schlägt Jochheim vor, zum Beispiel Nachlässe bei der Lehrverpflichtung. Einige Hochschulleiter führen außerdem turnusmäßig Gespräche mit jedem einzelnen Professor, um Ziele für das kommende Jahr zu vereinbaren, was beide Seiten als positiv empfinden. Denn so können Professoren zumindest sichtbar machen, was sie im vergangenen Jahr geleistet haben und Anerkennung dafür erhalten. Solche Gespräche wären auch eine Chance, mehr Transparenz in das System zu bringen.
Lichtblick: Motivierte Professoren
Bis die W-Besoldung Anreize liefert, ist es noch ein weiter Weg. Einen Lichtblick hat Linda Jochheims Studie aber zutage gefördert: Auch wenn die W-Besoldung wenig zusätzliche Anreize für Professorinnen und Professoren schafft, machen sie ihre Arbeit dennoch gern. Die Motivation, an der Universität zu arbeiten, bringen sie selbst mit.