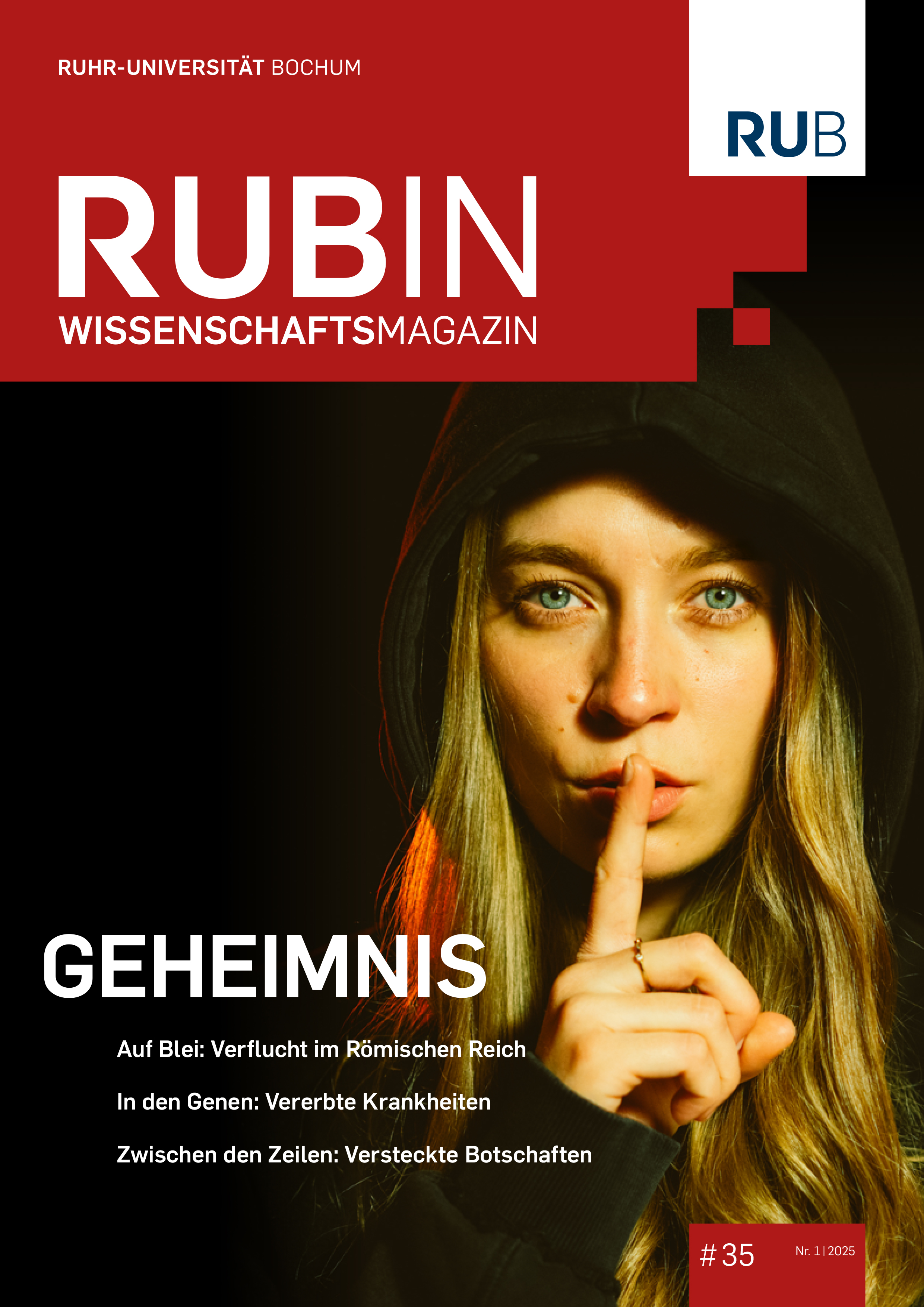Am Ende des Jahres fassen Managerinnen und Manager ihre Buchhaltung und Bilanzen über das gesamte vergangene Geschäftsjahr in einem Finanzbericht zusammen.
Betriebswirtschaftslehre
Die unsichtbare Handschrift
Wie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer in Finanzberichten Spuren hinterlassen.
Die Zeit rund um den Jahreswechsel ist für viele Unternehmen eine „busy season“. Während Managerinnen und Manager innerhalb kurzer Zeit ihre Buchhaltung und Bilanzen über das gesamte vergangene Geschäftsjahr in einem Finanzbericht zusammenfassen müssen, erfolgt vor der Offenlegung noch die Prüfung durch Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer. „Diese Offenlegung und Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben und soll der Transparenz dienen“, weiß Prof. Dr. Martin Nienhaus, der an der Ruhr-Universität den Lehrstuhl für Financial Accounting innehat. Doch wie transparent sind die Berichte wirklich? Und welchen Einfluss haben Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer auf den Finanzbericht? Gemeinsam mit Kollegen hat der Bochumer Betriebswirt in einer Studie mehrere Tausend Finanzberichte wissenschaftlich unter die Lupe genommen, ihre Wortwahl und Struktur analysiert und zahlreiche Interviews mit Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern geführt.
Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren
Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren
„Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern geht es in erster Linie um Regelkonformität“, betont Nienhaus. Es sei nicht ihre Aufgabe, zu beurteilen, ob ein Unternehmen profitabel sei, so der Betriebswirt. Da eine Prüfung nicht vollumfänglich sein kann, erfolgt sie in der Regel durch Zufallsstichproben und Plausibilitätschecks. Mithilfe von Checklisten überprüfen die Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer ausgewählte Finanzwerte auf deren Richtigkeit. So bitten sie beispielsweise Kunden oder Banken, bestimmte Salden zu bestätigen. Am Ende erteilen sie ein Testat. Doch wie unabhängig ist dieses Prüfungsergebnis? Wie groß ist der Einfluss der Prüferinnern und Prüfer auf Lageberichte und Anhänge? Zu ebendiesen Fragen hat Nienhaus mit seinen Kollegen Christoph Mauritz und Christopher Oehler geforscht.

Martin Nienhaus ist Inhaber des Lehrstuhls für Financial Accounting an der Ruhr-Universität Bochum, wissenschaftlicher Direktor und stellvertretender Geschäftsführer des Instituts für Unternehmensführung (ifu) und forscht zur Unternehmensberichterstattung.
Für ihre Studie durchforsteten die Forscher insgesamt über 6.000 Finanzberichte von 1.600 verschiedenen Prüfungspartnerinnen und -partnern. „Diese sind alle im Unternehmensregister öffentlich einsehbar“, erläutert Nienhaus. Die Länge der Berichte ist dabei von der Größe des Unternehmens abhängig. „Der Finanzbericht eines kleineren Unternehmens zählt vielleicht 20 Seiten; bei großen beläuft er sich teilweise auf 300 bis 400 Seiten“, weiß Nienhaus.
Wer unterliegt der Prüfungspflicht?
Wer unterliegt der Prüfungspflicht?
Das Hauptaugenmerk der Forscher lag nicht auf der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern auf dem Lagebericht und dem Anhang, also den narrativen Elementen des Finanzberichts. „Diese sind insofern besonders interessant für Kapitalgeber, weil sie teilweise zukunftsbezogene Infos enthalten und hilfreich für die Einordnung der gesamtwirtschaftlichen Lage eines Unternehmens sind“, erklärt Nienhaus. „In unserer Studie haben wir uns angeschaut, wie diese Berichte verfasst wurden, ob etwa ein Wirtschaftsprüfer seinen Fingerabdruck in Berichten unterschiedlicher Mandanten hinterlassen hat.“
Im internationalen Vergleich
Im internationalen Vergleich
Mithilfe des sogenannten Natural Language Processing (NLP), einem Ansatz aus dem Bereich Machine Learning, analysierten die Forscher, inwiefern sich die Finanzberichte unterschiedlicher Unternehmen im Hinblick auf Themen, Struktur und Wording ähneln. Die Auswertung ergab, dass es große textliche Übereinstimmungen zwischen den Finanzberichten von Unternehmen gibt, die entweder ökonomisch ähnlich dastehen oder die aus derselben Branche oder derselben Region kommen. „Der allergrößte Faktor, der die Ähnlichkeit von Finanzberichten zweier unterschiedlicher Unternehmen erklärt, ist jedoch der Prüfer oder die Prüferin“, hebt Nienhaus hervor.

Die Lageberichte zweier Unternehmen werden um etwa 30 bis 48 Prozent ähnlicher, wenn sie den gleichen Prüfungspartner als Abschlussprüfer hatten.
„Unsere Studie zeigt, dass die Lageberichte um etwa 30 bis 48 Prozent textuell, inhaltlich und strukturell ähnlicher werden, wenn zwei Unternehmen den gleichen Prüfungspartner als Abschlussprüfer hatten“, so Nienhaus. Interessant sei auch, dass die persönlichen Vorlieben des Prüfers oder der Prüferin deutlichere Spuren hinterlassen hätten als die der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der er oder sie angehöre. „Der Einfluss eines individuellen Prüfers auf den Bericht ist neunmal höher als der, den etablierte Routinen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf das Vorgehen des Prüfers oder der Prüferin haben.“ Besonders starken Einfluss haben sie, wenn der Mandant ein kleineres, nicht-börsennotiertes Unternehmen sei oder bislang wenig Erfahrung in der Vorbereitung von Finanzberichten gehabt habe.

Viele Interviewte sprachen von einem Balance-Akt zwischen Prüfung und Beratung.
Dass die Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer stark in die Berichterstattung mit eingebunden sind, bestätigen auch die acht Interviews, die Nienhaus und seine Kollegen mit Prüfern und Prüferinnen führten. Diese berichteten, dass die ersten Entwürfe der Finanzberichte häufig unvollständig und unpräzise formuliert seien. In vielen Fällen bräuchte es zwei bis drei Korrekturschleifen. Insbesondere in kleineren Unternehmen fehle es an Erfahrung und Expertise. „Viele Interviewte sprachen von einem Balance-Akt zwischen Prüfung und Beratung und legen den Schluss nahe, dass hier die Grenzen verschwimmen“, fasst Nienhaus zusammen. Im Interview sagte ein Wirtschaftsprüfer zum Beispiel: „Bei kleinen Unternehmen – und das sollte man wahrscheinlich nicht laut sagen – könnte ich mir vorstellen, dass der Prüfer in manchen Fällen selbst in die Tasten haut.“
Jahresabschluss: Fluch oder Segen?
Jahresabschluss: Fluch oder Segen?
Was folgt nun daraus? „Unsere Studie zeigt, dass die Prüferinnen und Prüfer ihre Expertise in die Erstellung von Berichten stärker einbringen als vielleicht angenommen“, so Nienhaus. Ihr Einsatz geht auch über das Einfügen von bestimmten Standard-Textpassagen hinaus. Das sei aber per se nichts Schlechtes.

Das Ergebnis sind qualitativ hochwertigere, vollständigere, gewissenhaftere Lageberichte.
Im Gegenteil: „Das Ergebnis sind qualitativ hochwertigere, vollständigere, gewissenhaftere Lageberichte“, so Nienhaus. Die Studie belege daher die wichtige Rolle von Prüfungspartnern für die narrative Berichterstattung. „Sie zeigt, dass insbesondere die kleineren Unternehmen Unterstützung in diesem Bereich brauchen. Man sollte diesen Bedarf ernst nehmen. Viele sind überfordert. Hier lohnt es sich nachzudenken, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, ihnen Hilfestellungen an die Hand zu geben.“