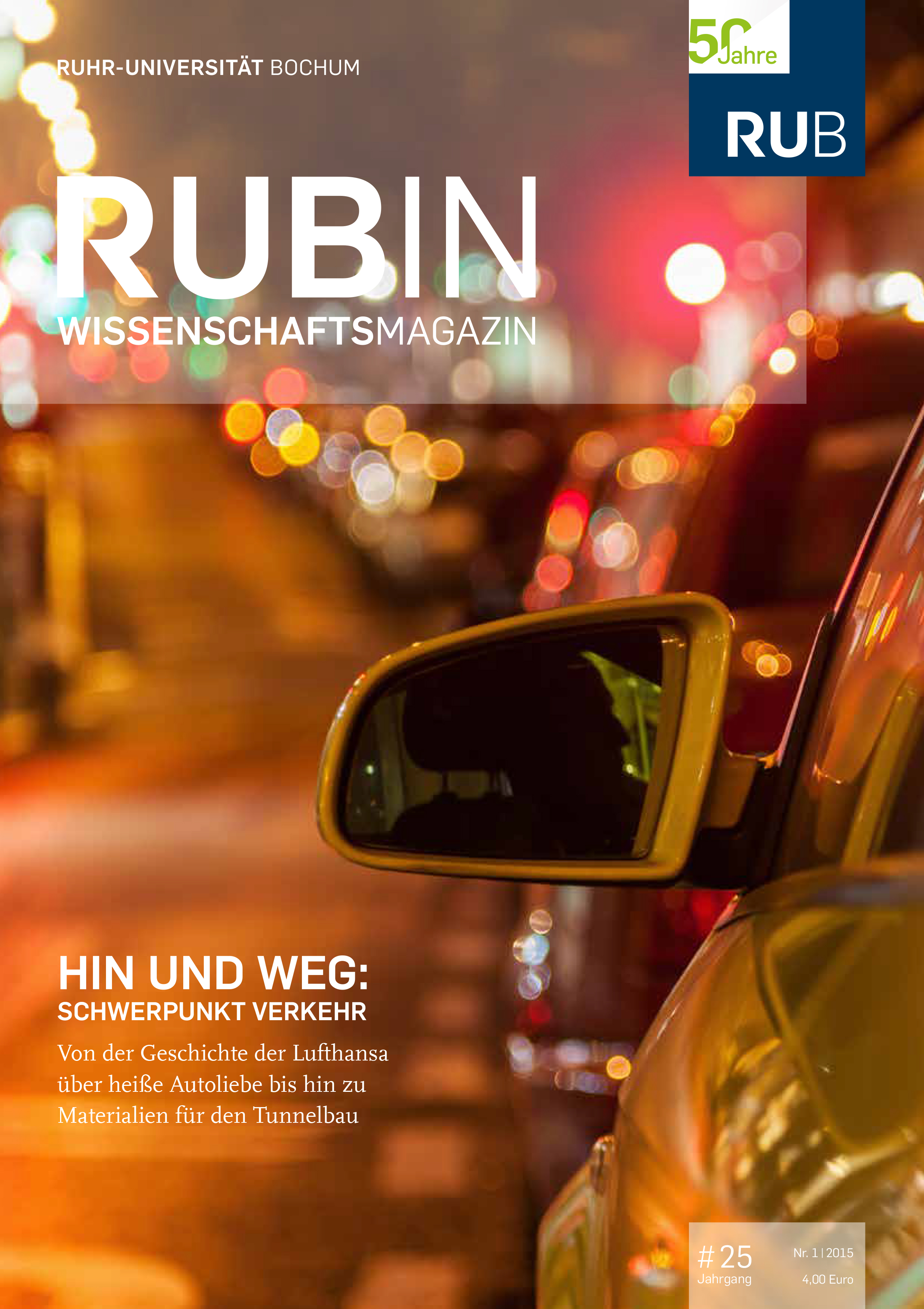Geschichte der Lufthansa
Herrschaft im Luftreich
Jahrelang hat RUB-Historiker Lutz Budrass die Geschichte der Lufthansa erforscht, im Auftrag des Unternehmens, das später eine Veröffentlichung ablehnte. Zu düster waren einige Details der Vergangenheit.
„Ich würde immer gern mit der Lufthansa fliegen“, erzählt RUB-Historiker Dr. Lutz Budrass. Ihn beeindruckt, dass der Konzern nur ein einziges Interesse verfolgt: profitablen Luftverkehr betreiben. Dabei könnte es sich zum Beispiel auch lohnen, Radaranlagen zu produzieren. Aber die Lufthansa bespielt keine industriellen Nebenschauplätze. Sie tut heute nur das, was sie schon immer tun wollte: Passagiere befördern und damit Geld verdienen. Das war aber nicht immer so.

Die Lufthansa hat wie eine geheime Rüstungsagentur gewirkt.
Lutz Budrass
„Gerade in den 1920er- und 30er-Jahren ging die Lufthansa sehr stark über den Luftverkehr hinaus“, sagt Budrass. „Sie hat wie eine geheime Rüstungsagentur gewirkt“. Am Historischen Institut der RUB hat der Forscher die Geschichte des Unternehmens bis in seine Anfänge nach dem Ersten Weltkrieg zurückverfolgt – der Auftrag dazu kam von der Lufthansa selbst; das Unternehmen wollte wissen, auf welche Weise es in Zwangsarbeit verwickelt gewesen war.
Als Budrass die Wahrheit ans Licht gebracht hatte, nahm der Konzern jedoch schnell Abstand von einer Veröffentlichung der Ergebnisse. Schade, findet der Bochumer Historiker. Denn die Lufthansa hat seiner Meinung nach beeindruckende Lehren aus ihrer Vergangenheit gezogen. Die „neue Lufthansa“ kann heute nur verstehen, wer die Geschichte der „alten Lufthansa“ kennt. Dazu muss man ganz zu den Anfängen zurückgehen.
Im Jahr 1919 präsentiert das deutsche Luftfahrtunternehmen Junkers mit der F13 erstmals ein Flugzeug, das profitablen Luftverkehr verheißt. Die Modelle der europäischen und amerikanischen Konkurrenz sind nicht wirtschaftlich, verbrauchen zu viel Sprit und können zu wenige Passagiere befördern.
„Die Leute bei Junkers haben sich der Illusion hingegeben, dass sie den Luftverkehr von heute auf morgen realisieren können“, fand Lutz Budrass heraus. „Dieser Blütentraum war 1920 aber schon wieder ausgeträumt“. Denn für Luftverkehr braucht es nicht einfach nur ein Flugzeug und einen arbeitslos gewordenen Piloten aus dem Ersten Weltkrieg. Es braucht Flugplätze, Kapital, Verkehrspiloten. Will das Unternehmen also in den Luftverkehr einsteigen und trotzdem Gewinn erzielen, benötigt es ein zweites Standbein: Rüstung.

Die Lufthansa entsteht 1926 aus „Junkers Luftverkehr“ und „Aero Lloyd“ mit der Absicht, Passagiere zu befördern. Aber im Hintergrund schwingen immer Rüstungsinteressen mit. Das große Problem: Die Versailler Verträge untersagen Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg jede Form von Luftrüstung, aber ohne Rüstung ist das Unternehmen nicht profitabel genug. Daher betätigt es sich im Verborgenen trotzdem auf diesem Gebiet, gelenkt vom Staat.
Immer wieder unternimmt Deutschland in internationalen Verhandlungen Anläufe, das Verbot zu lockern. Nach und nach dulden die anderen Länder die Rüstungsaktivitäten und sehen darin keinen Kriegsgrund mehr. Warum aber ist es für die Deutschen so wichtig, die Luft zu erobern?
„Nach dem Ersten Weltkrieg sollte die Luftfahrt der Ausweis für die wiedergewonnene deutsche Größe sein“, erklärt Budrass. „Außerdem gibt es im Ersten Weltkrieg eine ziemlich große Luftwaffe. Nach Kriegsende werden viele, die etwas mit Flugzeugen zu tun hatten, arbeitslos. Sie haben großes Interesse daran, dass der Bereich, in dem sie ihre Jugend verbracht haben, wieder groß wird.“ Es entwickelt sich eine regelrechte Luftfahrteuphorie (Abb. 2), auf der die Lufthansa lange Zeit mitschwimmt, massiv subventioniert vom Staat, dem 50 Prozent der Unternehmensanteile gehören. Budrass: „Sie ist deshalb stets ein Einfallstor für Rüstungsinteressen.“
Während der Weltwirtschaftskrise 1929 gerät dieses Konstrukt ins Wanken. Es wird diskutiert, die Subventionen zu streichen. Einige führende Personen im Unternehmen Lufthansa suchen neue Wege. Erhard Milch, Technischer Direktor der Lufthansa, schlägt sich früh auf die Seite der Nationalsozialisten, weil er die Chance wittert, mit deren Unterstützung den Luftverkehr weiter auszubauen.
„Milch hatte engen Kontakt mit Hermann Göring, dem zweiten Mann der Nationalsozialisten, der selbst Flieger im Ersten Weltkrieg war und auf der Luftfahrteuphorie der Zwanzigerjahre mitschwamm“, weiß der RUB-Historiker. So entwickelt die Lufthansa 1933 eine sehr starke Affinität zum Nationalsozialismus.
Als die Luftwaffe enttarnt wird, beginnt für die Lufthansa die große Zeit im Luftverkehr. Die Rüstungsinteressen müssen nicht mehr länger geheim gehalten werden, sie kann sich offen auf diesem Feld betätigen und hat so auch die Mittel zur Verfügung das zu tun, was sie schon immer tun wollte: Luftverkehr.
Kinder als Zwangsarbeiter
„Die zweite Hälfte der Dreißigerjahre ist die große Zeit der Lufthansa“, sagt Lutz Budrass. „Weil sie nicht mehr das geheime Vehikel für die Rüstungsindustrie ist, kann sie sich erstmals richtig auf den Luftverkehr konzentrieren.“ Erhard Milch, ehemaliger Direktor der Lufthansa, wird Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium und ist am Ende des Zweiten Weltkriegs Generalfeldmarschall, bekleidet also den zweithöchsten Rang in der deutschen Armee. Im Zweiten Weltkrieg beschäftigt die Lufthansa – wie alle deutschen Unternehmen – Zwangsarbeiter.
„Das ist nichts Besonderes“, sagt Budrass. „Aber um Flugzeuge zu reparieren und zu reinigen, musste man in Winkel kriechen. Daher wurden sehr viele kleine Menschen gebraucht.“ Auch wenn sich die Zahlen nicht eindeutig rekonstruieren ließen, fand der Historiker bei seinen Nachforschungen heraus, dass die Lufthansa viele Kinder für solche Arbeiten einsetzte. „Sie kamen nicht nur von den Arbeitsämtern, sondern wurden auch selbst aus Russland mitgebracht. Also quasi entführt.“
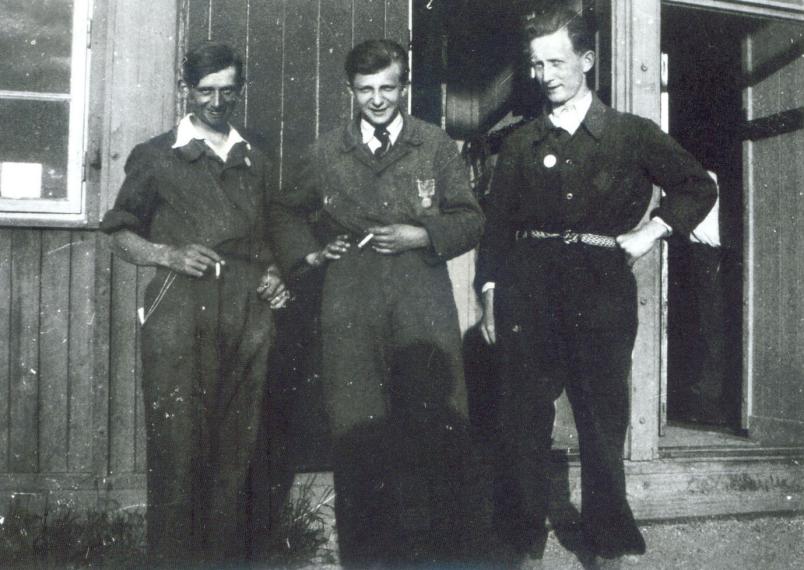
Um all diese bis dato unbekannten Fakten über die Historie des Unternehmens aufzudecken, verbrachte Budrass viele Tage in Archiven. Das Lufthansa-Archiv war keine allzu ergiebige Quelle, da es in Tempelhof lagerte und zum großen Teil im Krieg zerstört wurde. Doch die Luftfahrteuphorie der Vergangenheit kam Lutz Budrass zugute: „Viele Leute haben sehr viel Material gesammelt“, sagt er. Unter anderem wurde er im Bundesarchiv und im „Junkers“-Archiv fündig, das als verloren galt, bis es 1992 wiederentdeckt wurde.

Auf dem Höhepunkt der Luftrüstung Anfang der 1940er-Jahre sind 1,9 Millionen Menschen in Deutschland in der Flugzeugindustrie beschäftigt, die somit eine ähnliche Bedeutung hat wie die Automobilindustrie heute. Der Erfolg nimmt 1945 jedoch ein jähes Ende. Kein Deutscher darf mehr fliegen, bestimmt die Alliierte Gesetzgebung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges; die Luftfahrt wird komplett verboten.
Da die Alliierten die Lufthansa als Teil der Luftwaffe ansehen, muss das Unternehmen aufgelöst werden. Das passiert relativ spät, Ende 1950. Mittlerweile verkehren 20 europäische Luftverkehrsgesellschaften über Deutschland, aber es scheint keine große Hoffnung zu geben, dass je wieder eine deutsche unter ihnen sein wird.
Doch wieder einmal ist der Druck in Deutschland groß, in die Luftfahrt zurückzukehren. Zahlreiche Arbeiter in dieser Branche haben ihre Jobs verloren. Aber da ist noch mehr. Es geht um das Selbstwertgefühl eines Landes, denn es herrscht die Meinung: „Wir sind keine vollwertige Nation, wenn wir keine eigene Luftverkehrsgesellschaft haben.“
Ab 1951 wird daher intensiv diskutiert, eine neue deutsche Luftverkehrsgesellschaft zu gründen. „Das ist zunächst ziemlich geheim, man will sich nicht in die Karten gucken lassen“, beschreibt Budrass. „Die Alliierten dulden es, aber es ist ein langer Prozess.“
Neue Lufthansa will mit der alten nichts zu tun haben
Am 5. Mai 1955 wird offiziell die Lufthansa gegründet, die wir heute kennen. Und seither verfolgt sie konsequent drei Leitlinien: Nie wieder will sie nur der Absatzmarkt für die deutsche Luftfahrtindustrie sein; ihre Flugzeuge sucht sie nicht im nationalen Interesse aus, sondern kauft die Maschinen, die am wirtschaftlichsten sind. Der Konzern will finanziell unabhängig sein. Die Zahl der Personen im Bundesverkehrsministerium, die über die Lufthansa bestimmen dürfen, wird von Anfang an klein gehalten – sie will flexibel bleiben, nicht der Spielball zahlreicher Politiker sein. Bis 1960 ist das Unternehmen noch staatlich subventioniert, besteht aber darauf, langfristig unabhängig von diesen Geldern zu werden – und das gelingt auch. Heute ist die Lufthansa komplett privatisiert.
Die „neue Lufthansa“ sagt heute, sie habe mit der „alten Lufthansa“ nichts zu tun. Es sei ein anderes Unternehmen. Aber woher kommt diese Unternehmenspolitik, die seit der Neugründung 1955 konsequent eingehalten wird? Budrass meint, sie lässt sich nur auf Basis der Geschichte erklären. Schade sei es, mit dieser spannenden Historie nichts zu tun haben zu wollen.