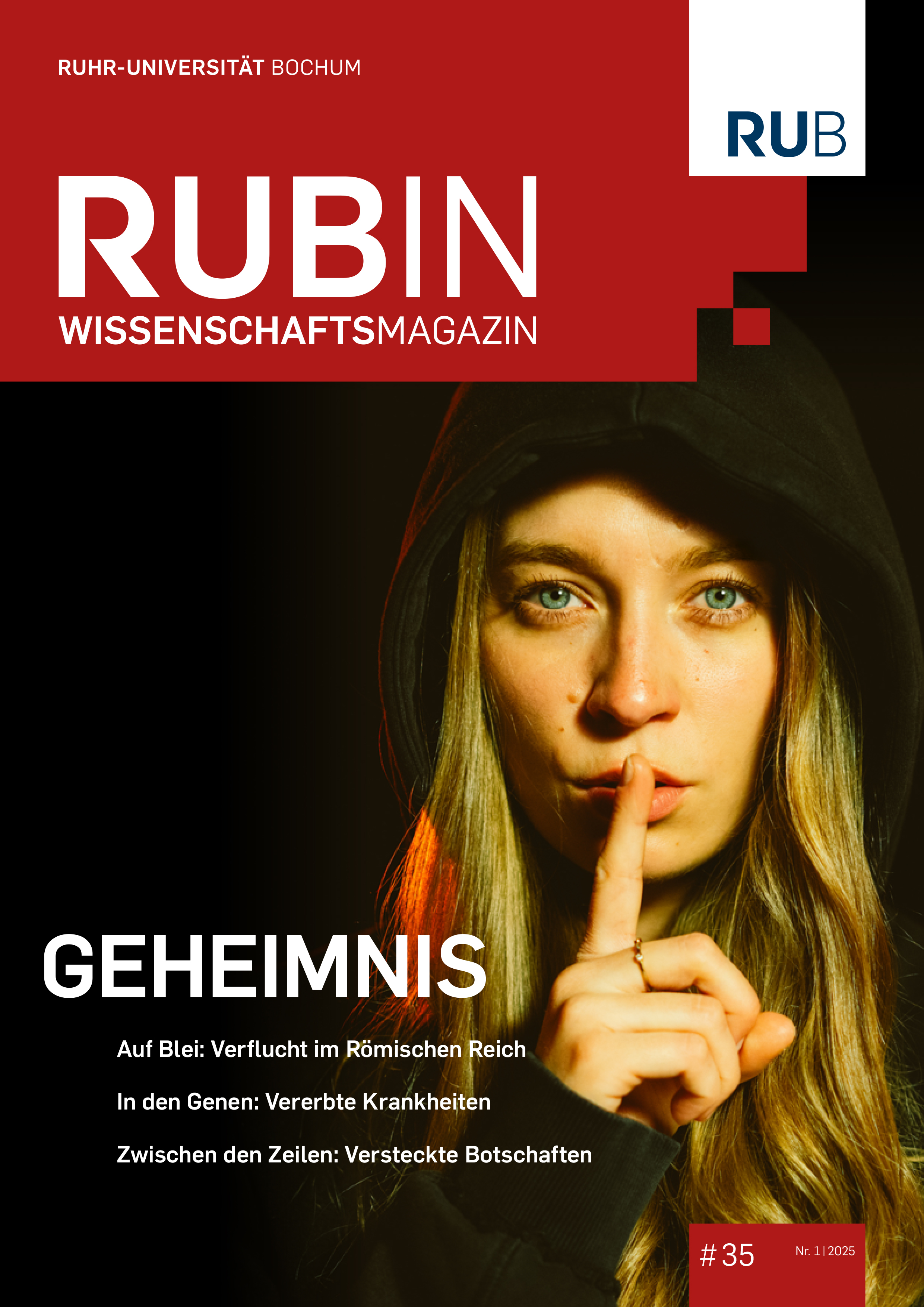Geschichte der Architektur
Eine Bühne für die Wissenschaft
In Anatomischen Theatern fanden ab der frühen Neuzeit öffentliche Zergliederungen von Leichen statt. Ein Akt zwischen Sichtbarmachung und Verschleierung.
Diese Vorstellung ist ihr Geld wert! Kerzenschein taucht den abgedunkelten Raum in weiches Licht. In den Pausen – die bei der mehrstündigen Vorführung dringend nötig sind – wird Musik gespielt. Und selbst von den oberen Rängen des Anatomischen Theaters hat man einen exzellenten Blick auf die Leiche, die in der Mitte des Raumes mit weit geöffnetem Bauchraum auf dem Zergliederungstisch liegt. Jedes einzelne Organ, das er mit seinem scharfen Skalpell heraustrennt, präsentiert der Anatom und hält dabei eine naturphilosophische Vorlesung in Anlehnung an Aristoteles, in der es weniger darum geht, bestimmte Krankheiten zu erkennen, als vielmehr darum zu lernen, wie der ideale Körper aufgebaut ist.
Den Bauplan Gottes für die Welt entschlüsseln
Eine abschreckende Szene? Aus unserer heutigen Perspektive vielleicht. Doch den Menschen des ausgehenden 16. Jahrhunderts dienten solche Aufführungen der umfassenden Bildung. Sie erfuhren hier nicht nur etwas über den menschlichen Körper, sondern auch etwas über sich selbst und den Bauplan Gottes für die Welt. Die Zergliederungen waren öffentlich, gegen Zahlung des Eintrittspreises konnten auch Gäste Platz auf den Rängen nehmen.
Kunsthistorikerin Prof. Dr. Christine Beese vom Arbeitsbereich Architekturgeschichte der Ruhr-Universität Bochum hat sich intensiv mit dem Thema befasst. Auslöser war der Begriff „Anatomisches Theater“, über den sie eines Tages stolperte. „Ich fand, das war eine sonderbare Bezeichnung. Wenn ein Raum für objektive und realistische Einblicke sorgen soll, warum nennt man ihn dann Theater? Warum taucht man ihn in schummeriges Licht? Sollte dort etwas verschleiert werden?“, fragte sich die Wissenschaftlerin.

Die Leichen, die in den anatomischen Theatern präpariert wurden, stammten oft von Hingerichteten.
Zwar spricht alleine schon die runde Anordnung der Ränge, bei der alle Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit hatten, auf den Körper zu schauen, für das Vorhaben der Sichtbarmachung und Transparenz. „Zur gleichen Zeit war es aber auch eine Inszenierung, die darauf setzte, dass es Geheimnisse der Natur gibt, die diese von selbst nicht preisgibt“, so Christine Beese.
Gerade bei den frühen Anatomischen Theatern, zum Beispiel im italienischen Padua, verstärkte die Architektur die geheimnisvolle Atmosphäre. Der Hörsaal war trichterförmig aufgebaut, der Weg hinein labyrinthisch. An der Seite gingen Treppen hoch. Die Leichen wurden aus einem anderen Raum hereingebracht, wobei die Körper schon geöffnet waren, was den Blick der Zuschauenden bewusst lenkte. Der Anatom zelebrierte seine Sektion, in den Pausen gab es Musik, Kerzen wurden angezündet, die Fenster verdunkelt.

Der Raum und die Veranstaltung waren dazu gedacht, das Wunder der Natur zu inszenieren.
„Es ging schon um Sichtbarkeit“, so Beese. „Aber sie war stark gelenkt und inszeniert. Es gab kein helles Licht, man konnte die Organe nicht selbst in Augenschein nehmen. Der Raum und die Veranstaltung waren dazu gedacht, das Wunder der Natur zu inszenieren.“
In der Zeit, in der die ersten bekannten Anatomischen Theater gebaut wurden, hatte man die Vorstellung, dass der menschliche Körper als Mikrokosmos Teil des Makrokosmos ist. Bestimmte Organe wurden bestimmten Planeten zugeschrieben. Alles, was im Makrokosmos passierte, hatte Einfluss auf den Körper und andersherum konnte man durch das Verständnis des menschlichen Körpers Rückschlüsse auf Gottes Plan für das Universum ziehen.

Man wollte mit den Zergliederungen das Publikum daran erinnern, dass man sterblich ist, dass man ein tugendhaftes Leben führen soll im Einklang mit der Gesellschaft und christlichen Werten
„Es hat sich im Laufe der Zeit verändert, was man meinte, im Anatomischen Theater zu sehen. Weil das auch damit zu tun hat, was in der jeweiligen Zeit für ein Körperkonzept vorherrschte“, so Beese. Im 17. Jahrhundert überwog zum Beispiel die moralische Erziehung. „Man wollte mit den Zergliederungen das Publikum daran erinnern, dass man sterblich ist, dass man ein tugendhaftes Leben führen soll im Einklang mit der Gesellschaft und christlichen Werten“, sagt die Wissenschaftlerin.
Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren
Wissenschaftsmagazin Rubin kostenlos abonnieren
Im frühen 20. Jahrhundert war das Anatomische Theater bei Medizinhistorikern und Architekturhistorikern als Forschungsgegenstand sehr beliebt, weil man diese Gebäude so verstand, als seien sie aufgrund ihrer Trichterform eine Art umgekehrtes Teleskop, eine Sehmaschine. „Aber eine rein technische Funktion hatten diese Räume überhaupt nicht in der frühen Neuzeit, also im 16. und 17. Jahrhundert“, gibt Christine Beese zu bedenken. „Die Menschen, die die ersten anatomischen Theater gebaut haben, hatten ein viel umfassenderes Verständnis von der Wirkung der Architektur, als Historiker*innen lange annahmen.“ Im Sinne der aristotelischen Seelenlehre wurde Erkenntnis durch die Erfahrung aller menschlichen Sinne erzeugt. Der menschliche Körper, seine Organe und Sinne standen in einem seelischen Zusammenhang mit der physischen Umwelt. Heute privilegieren wir dagegen das Auge und den Sehsinn. „Diese Räume bekommen in dem Maße einen Instrumentencharakter, wie wir sie als solche ansehen. Die bauliche Grundstruktur ändert sich eigentlich nicht, sondern unsere Erwartung an sie. Und was wir damit verbinden, bestimmt unsere Wahrnehmung“, sagt die Kunsthistorikerin.

So ähnlich wie bei diesem Modell waren die Ränge in den meisten anatomischen Theatern angeordnet.
Für ihre Forschung war ihr daher eins wichtig: „Dadurch, dass sich das Denken der Menschen in der Frühzeit so stark von unserer heutigen Perspektive unterscheidet, bedarf es wirklich eines bestimmten Schrittes, um sich freizumachen von der persönlichen Sichtweise. Dadurch erfährt man aber auch viel darüber, wie stark konditioniert das ist, was man selbst denkt. Dass das auch nur eine Möglichkeit von vielen ist“, so Beese.
Bevor die ersten festen Gebäude für die Sektionen erbaut wurden, fanden diese übrigens unter freiem Himmel, im Innenhof der Universitäten statt. Auch dort saß das Publikum bereits auf Rängen, die allerdings nicht permanent dort standen, sondern auf- und abgebaut werden konnten. Diese Tribünen gab es beispielsweise auch bei öffentlichen Hinrichtungen. Da die Leichen für die öffentliche Zergliederung meist hingerichtete Delinquenten waren, verstärkte sich die abschreckende Wirkung auf die Zuschauer, was ihre moralische Erziehung anging.
Es gab einen Wissenswettbewerb zwischen den Nationen
Doch wie kam es dazu, dass man von diesen Freiluft-Tribünen abwich und Gebäude errichtete? Christine Beese fand die Antwort während ihrer umfangreichen Literaturrecherche: „Die Universitäten standen damals unter dem Druck, mehr praktisches und anwendungsbezogenes Wissen zu vermitteln. Es gab einen Handels- und Wissens-Wettbewerb zwischen den Nationen. Man sollte technische Entwicklungen vorantreiben. Die Mediziner wollten ihren Status festigen, indem sie angewandte Forschung aufnahmen, und dafür wurden explizit Räume geschaffen.“
Einige der Anatomischen Theater sind recht prunkvoll. Und auch das hat Gründe: „Universitäten waren angewiesen auf Förderer, ähnlich wie wir heutzutage auf Drittmittelgeber. Und man überzeugte einen Geldgeber – oft Fürsten oder wohlhabende Kaufleute – wahrscheinlich auch dadurch, dass man ihm ein repräsentatives Gebäude für sein Geld in Aussicht stellte“, so Beese.
Räume als Kunstwerke
Ihr Wunsch für ihre Forschungsarbeit: „Viele dieser Räume werden in der Öffentlichkeit nicht als Kunstwerke wahrgenommen. Ich möchte das ändern. Der Kunstwerk-Charakter war Teil ihrer Aufgabe bei der Wissenserzeugung“, so Christine Beese. Heute denken wir meist, es gäbe eine Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft. In der Wissenschaft werden neue Erkenntnisse erzeugt, in der Kunst werden Dinge verhandelt. „Aber diese Trennung gab es zur Zeit dieser Gebäude überhaupt nicht“, sagt Beese. Damals hatte man laut ihr die Vorstellung, dass Wissen ganzheitlich ist. Dass es immer auch darum geht zu wissen, was gute Lebensführung ist. Was muss man wissen, um Gottes Plan umzusetzen? „Die frühen Anatomischen Theater verhandeln all dieses. Nicht nur über den performativen Akt, wenn der Körper geöffnet wird und man dabei eine Vorlesung erhält. Mir ist wichtig zu betonen, dass das genauso auch über die Architektur selbst verhandelt wurde“, so die Kunsthistorikerin.