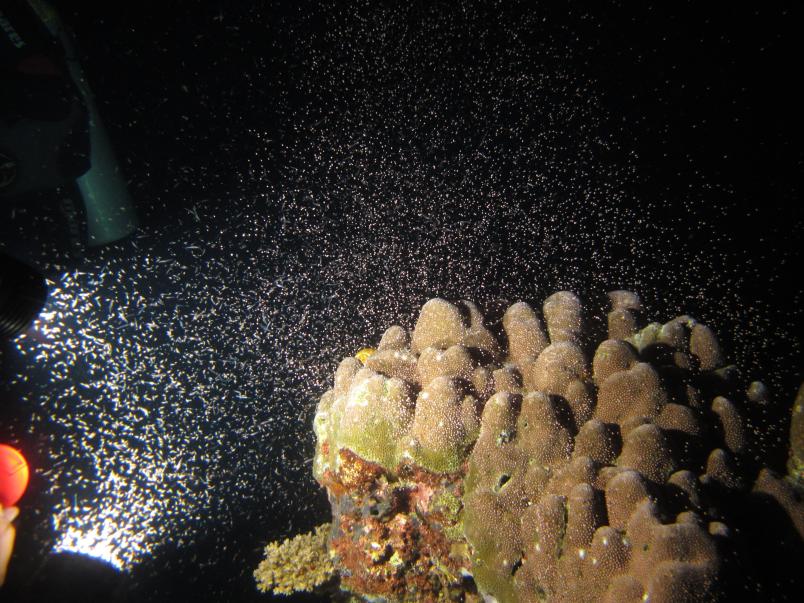Paläontologie
Erste Röntgenbilder einer fossilen Zecke
Warum Forscher eine in Bernstein eingeschlossene Zecke in den Computertomografen gelegt haben, erklärt eine aktuelle Studie.
Mit Röntgenstrahlen haben Wissenschaftler detaillierte Aufnahmen einer Zecke gemacht, die seit Jahrmillionen in Bernstein eingeschlossen ist. Es war das erste Mal, dass eine Bernstein-Zecke im Computertomografen (CT) untersucht wurde. Die Bilder geben Aufschluss über die Verwandtschaftsverhältnisse zu heute noch lebenden Arten.
„Fossile Zecken sind extrem selten“, sagt Dr. René Hoffmann, Paläontologe am RUB-Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik. „Wir wissen daher nicht genau, wie ihre Evolution verlaufen ist.“ Mithilfe von Fossilien können Forscher den Stammbaum einer Spezies rekonstruieren – aber nur, wenn sie die Tiere richtig bestimmen und korrekt systematisch einordnen.
Falsche Verwandtschaft vermutet
Das Exemplar, das Hoffmann und seine Kollegen aus Deutschland, Großbritannien und den USA im CT untersuchten, hatten andere Wissenschaftler bereits in früheren Studien beschrieben. Es ist 44 bis 49 Millionen Jahre alt und stammt aus dem Baltikum.
Damals hatten die Autoren vermutet, dass die Bernstein-Zecke – mit lateinischem Namen Ixodes succineus – verwandt ist mit der heute hauptsächlich in Europa lebenden Schafszecke Ixodes ricinus. Die neuen hoch aufgelösten Bilder zeigen jedoch, dass es äußerlich kaum Ähnlichkeiten zwischen diesen Arten gibt.

Stattdessen schließen René Hoffmann und seine Kollegen, dass der nächste heute noch lebende Verwandte der baltischen Bernstein-Zecke in Asien heimisch ist und der Spezies Partipalpiger angehört. Die Daten legen somit nahe, dass die Partipalpiger-Linie früher einmal auf der Nordhalbkugel verbreitet war, weil sie auch in Europa vorkam. Dort starb sie irgendwann aus, sodass sie heute nur noch in Asien zu finden ist.
Überträger von Krankheiten
„Die Analyse dieser fossilen Zecke ist auch deshalb interessant, weil ihre heute lebenden Verwandten Krankheitsüberträger sind“, erzählt René Hoffmann. Eine Rekonstruktion ihres Stammbaums könne einen Einblick geben, wann die Tiere zu Überträgern pathogener Keime wurden. Vielleicht war sogar schon das in Bernstein konservierte Exemplar von Ixodes succineus ein Krankheitsüberträger. In ihren Röntgenbildern sichteten die Wissenschaftler allerdings keine Bakterien oder anderen Keime.
Ihre Ergebnisse berichten sie in der Zeitschrift „BMC Evolutionary Biology“.