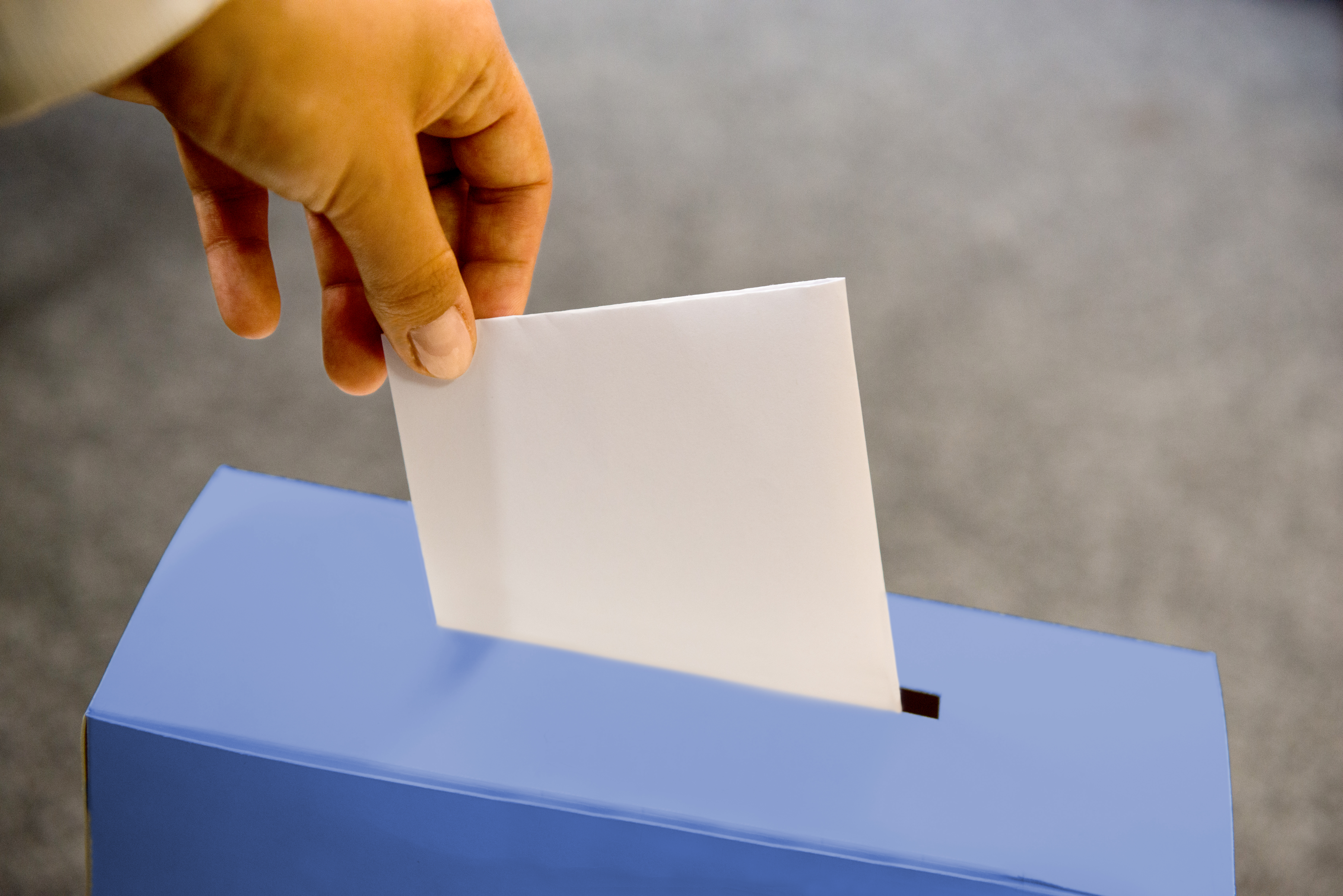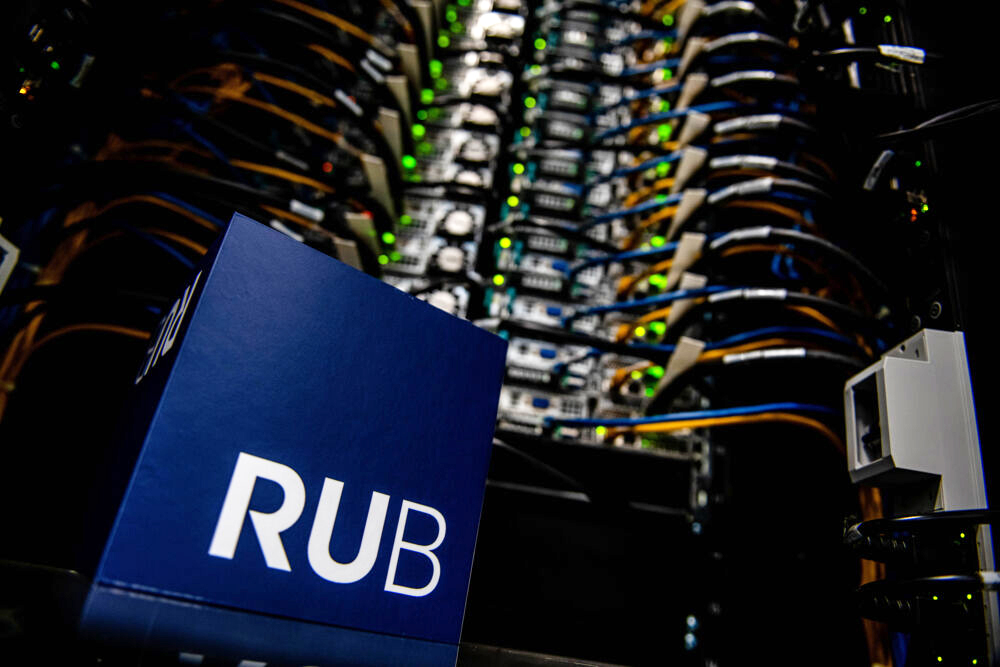Neurowissenschaft „Wir sollten unseren bisherigen Forschungsansatz überdenken“
Ein Team von Hirnforschern blickt über die wissenschaftliche Routine hinaus – und fordert eine bessere Vernetzung in der eigenen Disziplin.
„Wenn wir verstehen wollen, wie das Zusammenspiel von Molekülen unser Verhalten prägt, müssen wir unseren bisherigen Forschungsansatz überdenken.“ So lautet das Fazit eines Übersichtsartikels, den ein Team von Hirnforschern in der Fachzeitschrift „The Neuroscientist“ veröffentlicht hat. Sie fordern einen ganzheitlicheren Ansatz in der Neurowissenschaft.
Unter den Autoren sind auch zwei Mitglieder der Medizinischen Fakultät der RUB: Prof. Dr. Klaus Funke und Prof. Dr. Tobias Schmidt-Wilcke, der außerdem Mitglied des Sonderforschungsbereichs 874 an der Ruhr-Universität ist.
Forschung auf verschiedenen Skalen
Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler forschen auf vielen verschiedenen Ebenen: Einige zeichnen Hirnaktivierungen bei Tieren oder menschlichen Probanden auf, während diese bestimmte Aufgaben absolvieren; andere ergründen die Arbeitsweise von einzelnen Zellen oder sogar einzelnen Molekülen. Zwischen diesen groß- und kleinskaligen Forschungsansätzen gibt es zahlreiche andere Methoden, die wiederum andere dazwischenliegende Komplexitätsgrade im Fokus haben, etwa Zellverbünde unterschiedlicher Größenordnung.
„Neurowissenschaftler müssen sich entlang dieser Komplexitätsskalen besser vernetzten und sich über ihre Erkenntnisse austauschen“, fordert Tobias Schmidt-Wilcke. Die gewonnenen Ergebnisse dürften nicht einfach im enggesteckten Fachkollegenkreis verdunsten, sondern müssten gezielter weitertransportiert werden. Nur so könnten letztendlich alle Puzzlesteine zusammengefügt werden, um zu verstehen, wie Verhalten entsteht.
Der wichtigste hemmende Botenstoff im Gehirn
Die Autoren untermauern ihre Meinung anhand eines Beispiels: Sie setzen sich in dem Artikel mit dem Botenstoff Gamma-Amino-Buttersäure auseinander – dem wichtigsten hemmenden Botenstoff im zentralen Nervensystem. Vieles über die Nervenzellen, die Gamma-Amino-Buttersäure produzieren, ist bereits bekannt: ihr äußeres Erscheinungsbild, ihre Rezeptoren und ihr elektrochemisches Verhalten.
Forscher beackern das Feld aber auch am anderen Ende der Skala: Sie korrelieren zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen mit der Konzentration des Botenstoffs in einzelnen Gehirnbereichen, die etliche Millionen Nervenzellen enthalten.

Diese Signale sind wahrscheinlich das fehlende Bindeglied.
Tobias Schmidt-Wilcke
Gamma-Amino-Buttersäure spielt eine entscheidende Rolle bei der Synchronisation von Zellaktivitäten. Die zeitliche Abstimmung ist wichtig, um Signale auf Ebene der Zellverbünde zu generieren. „Diese Signale sind wahrscheinlich das fehlende Bindeglied zwischen molekularer und zellulärer Ebene auf der einen Seite der Komplexitätsskala und Wahrnehmung und Kognition auf der anderen Seite“, vermutet Schmidt-Wilcke.
Hochspezialisierte Fachbereiche verknüpfen
„Die Herausforderung ist es, die hochspezialisierten Fachbereiche zusammenzubringen, die auf verschiedenen biologischen Größenskalen arbeiten“, sagen die Autoren des Artikels. Sie tragen eine Reihe von Forschungsergebnissen zur Gamma-Amino-Buttersäure zusammen und leiten daraus künftige Forschungsfragen ab, die helfen könnten, die derzeit existierende Lücke zu schließen.