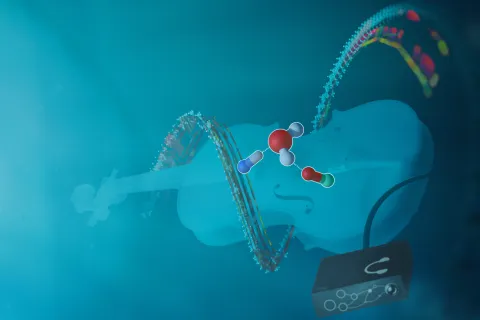Geografie
Fünf Prinzipien für klimasichere Kommunen und Städte
Die jüngsten Ereignisse verdeutlichen es drastisch: Wetter-Ausschläge werden extremer. Forschende geben Hinweise für die Anpassung von Städten und Gemeinden.
Bessere Frühwarnsysteme, Schwammstädte, Klimaprüfung kritischer Infrastrukturen, Klimasicherheit von Gebäuden und nicht zuletzt Kooperation und Solidarität: Auf diese fünf Prinzipien kommt es an, um Städte klimasicher zu gestalten. Das halten Forschende in einem Statement fest, das unter der Koordination des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) entstanden ist. Von der RUB ist Prof. Dr. Christian Albert daran beteiligt. Der Experte für Landschaftsplanung und naturbasierte Lösungen leitet die Professur für Umweltanalyse und -planung in metropolitanen Räumen.
Zuerst die Dürresommer 2018 und 2019, jüngst die Hochwasserkatastrophe nach dem Starkregen: Wetterextreme werden infolge des Klimawandels häufiger und können existenzbedrohend sein. Die Forschenden fordern daher: „Es ist an der Zeit, ähnlich wie beim Klimaschutz, ein groß angelegtes Klimaanpassungsprogramm auf den Weg zu bringen. Es gilt, das Risikomanagement von Wetterextremen und den Bevölkerungsschutz sowie die strategische Planung in Kommunen und Städten weiter zu stärken. Ziel muss es sein, die Klimasicherheit von Gemeinden und Städten auf ein neues Fundament zu stellen. Dafür bedarf es der weiteren Verbesserung unserer Wissensgrundlage, aber auch der Kooperation aller Akteure, inklusive der Politik und der Behörden von Bund und Ländern, privater Unternehmen, Vereine sowie der einzelnen Menschen vor Ort.“
Auf fünf Prinzipien komme es an:
Frühwarnsysteme verbessern und den Bevölkerungsschutz stärken
Auch für kleinere Flusseinzugsgebiete gilt es, die Vorhersage von Hochwasserwellen zu verbessern und zuverlässige Warnsysteme aufzubauen. Neben der Entwicklung von robusten Vorhersage-Modellen ist die Etablierung einer dauerhaften und verlässlichen Kommunikation mit Vertreterinnen und Vertretern von Städten und Gemeinden sowie den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort unerlässlich. Nur eine Warnung, die Menschen verstehen und der sie vertrauen, wird zu den gewünschten Handlungen führen.
Schwammfähigkeit und Speicherfähigkeit steigern
Neben etablierten Schutzlösungen wie Deichen, Mauern und Poldern, gilt es vermehrt, Gemeinden, Städte und Landschaften wie Schwämme zu konzipieren und den Wasserrückhalt in der Landschaft zu verbessern. Jeder Kubikmeter Wasser, der nicht über die Kanalisation in Bäche und Flüsse eingeleitet wird, trägt zur Abflachung von Hochwasserwellen bei, kann diese aber, wie bei den Ereignissen 2021, nicht verhindern. Daher gilt es, den Wasserrückhalt und das Speichervermögen von Flussauen, Wald- und Agrarlandschaften, aber auch in den dichter besiedelten Bereichen durch zusätzliche Grün- und Freiflächen zu steigern. Gerade für extreme Niederschläge sind zusätzliche Speicherräume und grüne Infrastrukturen so zu konzipieren, dass diese auch als Notwasserwege im Fall der Fälle vorbereitet sind. Ein hohes Speichervermögen für Wasser hilft nicht nur in Hochwasser-, sondern auch in Trockenzeiten.
Klimaprüfung von kritischen Infrastrukturen durchsetzen
Bei der Sanierung, dem Wiederaufbau nach Katastrophen und dem Neubau von öffentlichen Infrastrukturen und Gebäuden – insbesondere sogenannten kritischen Infrastrukturen – gilt es, die Folgen des Klimawandels abzuschätzen und Bemessungswerte entsprechend zu erneuern. Dies schließt auch die Berücksichtigung von Kaskadeneffekten durch die Unterbrechung von Versorgungsleistungen in Infrastruktursystemen ein. Infrastrukturen (Versorgung mit Wasser, Strom), das Rückgrat unserer modernen Gesellschaft, müssen so konzipiert werden, dass sie auch in extremen Wetterlagen funktionieren oder entsprechende Rückfalloptionen erlauben. Es ist nicht hinnehmbar, wenn gerade während einer Krise notwendige Kommunikationsnetze, medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen ausfallen, da sie nicht hinreichend auf solche Extremereignisse vorbereitet sind.
Klimasicherheit von Gebäuden fördern
Beim Wiederaufbau, Neubau beziehungsweise der Sanierung im Bestand gilt es, die Klimasicherheit von Gebäuden von Anfang an mitzudenken und den Schutzstandard zu erhöhen, insbesondere auch von Einrichtungen, die besonders vulnerable Gruppen wie Kinder, Senioren oder behinderte Menschen beherbergen. Dafür bedarf es, ähnlich wie bei der energieeffizienten Sanierung, finanzieller Förder- und Anreizinstrumente sowie der Etablierung vorsorgeorientierter Versicherungsprämien. Auch bei Bauanträgen und Immobilienverkäufen sollten systematisch entsprechende Informationen über Starkregen- oder Hochwassergefahren bereitgestellt und abgefragt werden. Zukunftsherausforderungen im Gebäudebestand allein appelativ beziehungsweise reaktiv meistern zu wollen, wird nicht ausreichen.
Gestaltungs- und Durchsetzungswille ist ebenso notwendig wie Kooperation und Solidarität
Für den Umbau bedarf es des Innovations- und Gestaltungswillens auf Seiten von Städten, Gemeinden, Investoren und Privatpersonen ebenso wie des Einsatzes von Finanzierungs- und Anreizinstrumenten auf Seiten des Bundes beziehungsweise der Länder. Es braucht durchsetzungsstarke Instrumente in der Planung sowie kohärente und standardisierte Rahmenwerke und Vorgehensweisen. Des Weiteren sind Nutzen und Lasten des Umbaus hin zu klimasicheren Städten und Gemeinden solidarisch zu verteilen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Gemeinden, die im Oberlauf von Flüssen mehr Raum für Wasser schaffen, werden davon nur indirekt profitieren; Gemeinden im Unterlauf aber unmittelbar, da das Überflutungsrisiko reduziert wird.