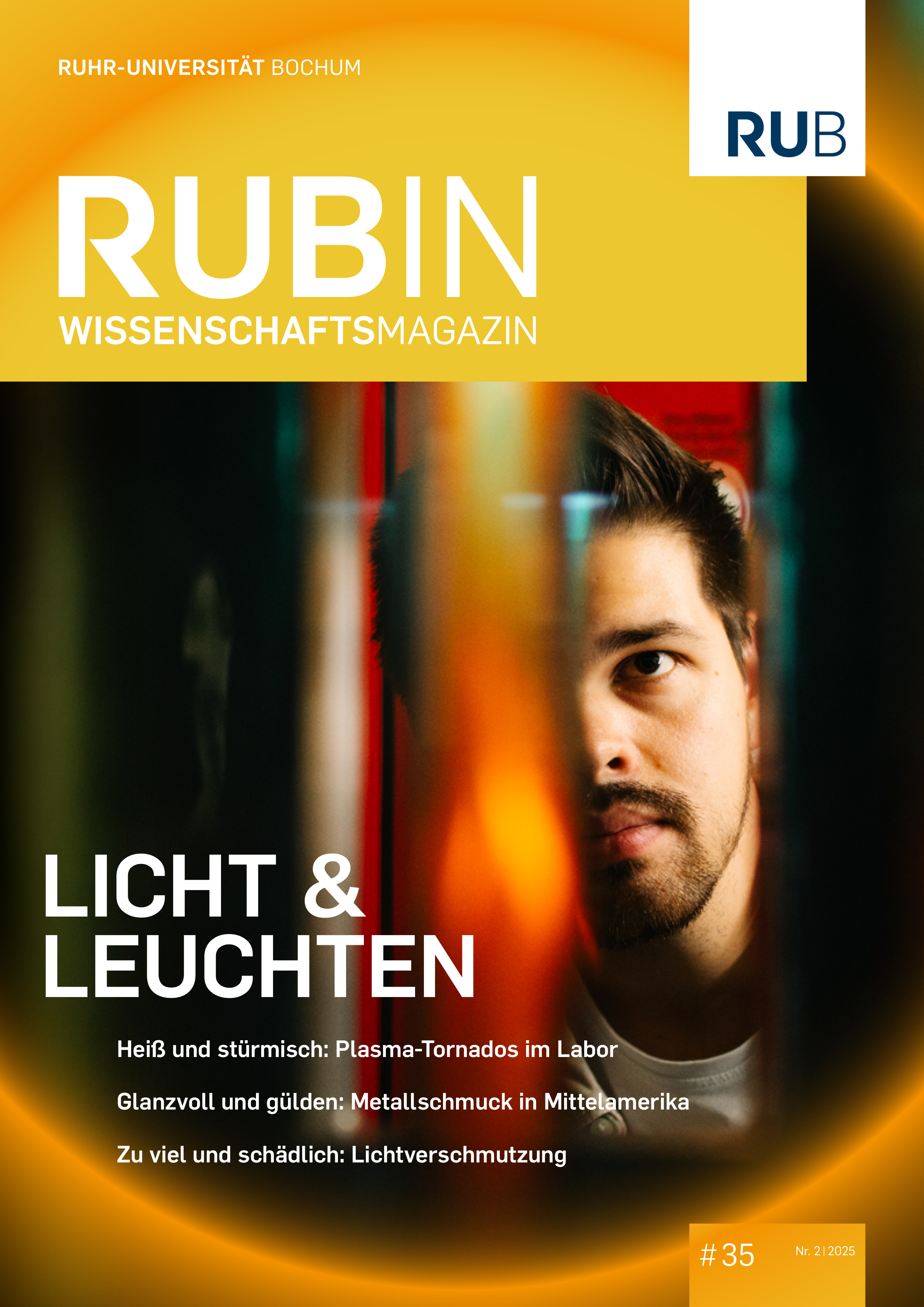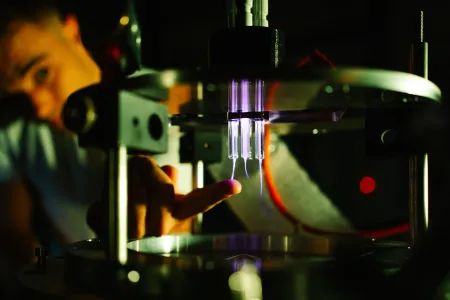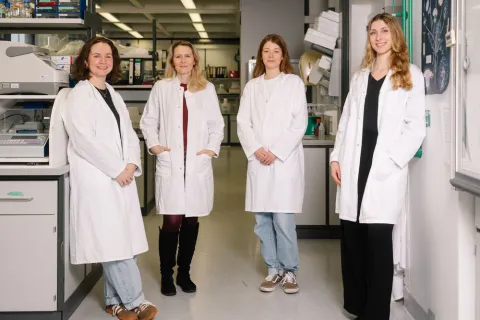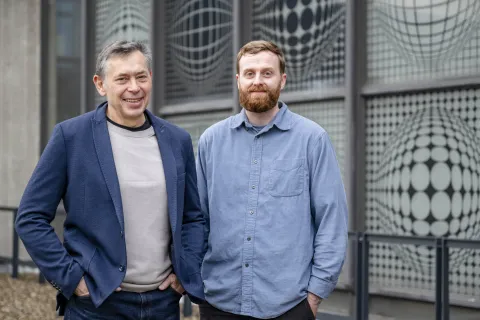Entwicklungspsychologie
Tablet vor dem Einschlafen ist gar nicht so schädlich wie gedacht
Das blaue Licht, das Tablets abstrahlen, steht im Verdacht, den Schlaf zu erschweren. Doch eine aufwendige Studie mit Kindern konnte dies nicht bestätigen.
„Nur eine Folge und dann geht’s ins Bett!“ Mit diesen Worten läuten wohl sehr viele Eltern das abendliche Zubettgehen-Ritual ihrer kleinen Kinder ein. Doch viele plagt dabei auch das schlechte Gewissen. Hört man doch immer wieder, dass das von diesen Geräten abgegebene blaue Licht uns das Einschlafen erschwert, da es die Produktion des Schlafhormons Melatonin beeinflusst.
Babyschlaf und Mediennutzung
Die drei Wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Sabine Seehagen, Neele Hermesch und Dr. Carolin Konrad vom Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie der Ruhr-Universität Bochum wollten wissen, ob an dieser Vermutung wirklich etwas dran ist, und konzipierten eine aufwendige Studie.
„Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema Babyschlaf und Mediennutzung, es besteht daran auch ein sehr großes Interesse von Eltern, aber auch Forschenden“, sagt Sabine Seehagen. „Allerdings ist dieses Forschungsfeld sehr geprägt von korrelativen Studien, wo geschaut wird: Wie lange schlafen die Kinder? Wieviel Medienzeit hatten sie? Diese Vorgehensweise sagt aber noch nicht wirklich etwas darüber aus, ob die Medien ‚Schuld‘ sind an dem schlechten Schlaf. Oder ob doch etwas ganz anderes dahintersteckt. Das ist auch keine triviale Frage, und sie ist nicht nur aus wissenschaftlicher, sondern auch aus ganz praktischer Sicht interessant. Das war der Grund, warum wir experimentell arbeiten wollten“, so Seehagen.
Kinderzimmer statt Labor
Während die allermeisten Experimente in dem Bereich mit Erwachsenen in Laboren durchgeführt werden, war es den drei Bochumer Entwicklungspsychologinnen ein großes Anliegen, die Kinder in ihrem häuslichen Umfeld zu testen und zu beobachten, um zu verstehen, welche Bedeutung das Tablet für den Schlaf im Alltag hat.
Die 32 teilnehmenden Familien mit Kindern zwischen 15 und 24 Monaten wurden von den Forscherinnen jeweils zweimal besucht und instruiert.
Im Zentrum des Experiments stand die Frage, ob das Anschauen einer Geschichte auf dem Tablet andere Folgen für die Ausschüttung von Melatonin und den Nachtschlaf hat als das Anschauen derselben Geschichte in einem Bilderbuch.
Die Studie wurde von den Eltern selbst durchgeführt, nämlich an zwei Abenden in der Stunde vor dem Zubettgehen der Kinder. Hier wären anwesende fremde Personen natürlich ein zu großer Störfaktor gewesen. Zusammen mit ihren Eltern schauten die Kinder sich eine Geschichte an einem Abend auf dem Tablet an und an einem anderen Abend wurde sie ihnen vorgelesen. Dem kurzwelligen Licht des Tablets waren sie also nur an einem Abend ausgeliefert.
Versuchsdurchführung Melatoninstudie
Versuchsdurchführung Melatoninstudie
Die Kinder bekamen zudem eine Schlafuhr ans Fußgelenk, welche die Bewegungen in der Nacht durch Sensoren wahrnahm. Dadurch konnten die Wissenschaftlerinnen anschließend Rückschlüsse über das Schlafverhalten ziehen, zum Beispiel Schlafdauer, -qualität und Einschlafzeit.
„Da wir uns besonders dafür interessiert haben, ob es eine Veränderung in der Melatoninausschüttung in der Abendstunde durch das Licht vom Bildschirm gibt, wollten wir verhindern, dass andere Lichtquellen unseren Versuchsaufbau torpedieren. Wir haben den Eltern daher eine Nachttischlampe zur Verfügung gestellt, und sie gebeten, andere helle Lichtquellen und Bildschirme zu vermeiden“, erklärt Neele Hermesch das Vorgehen.
Melatonin und blaues Licht
Melatonin und blaues Licht
Der Melatoninspiegel eines Menschen lässt sich in Körperflüssigkeiten nachweisen, unter anderem im Speichel. Die Eltern entnahmen ihren Kindern daher jeweils vor und nach der Tabletnutzung und dem Bilderbuchlesen Speichelproben, welche im Anschluss im Labor untersucht wurden.
„Wir haben an dem Abend mit Tablet einen flacheren Anstieg in der Melatoninausschüttung erwartet als an dem Abend mit Bilderbuch", so Carolin Konrad. Dies würde dafür sprechen, dass das Blaulicht, das von dem Tablet abgestrahlt wird, die Melatoninproduktion unterdrückt.
Überraschende Ergebnisse
Doch überraschenderweise bestätigten die Daten diese Annahme nicht. Die Forscherinnen beobachteten zwar den erwarteten Anstieg des Melatonins über die Zeit hinweg, aber das Melatonin stieg gleich viel an – egal ob Tablet geschaut wurde oder ein Bilderbuch. „Auf Basis der Studie würden wir nicht davon ausgehen, dass das Blaulicht dazu geführt hat, dass das Melatonin verzögert ausgeschüttet wurde“, fasst Neele Hermesch die Beobachtungen zusammen.
Betrachtet man vorhergegangene Studien zum Thema Tabletnutzung und Melatoninausschüttung, so sind die Ergebnisse relativ heterogen. Manche sprechen dafür, dass es einen Effekt gibt, andere dagegen. Nach aktuellen Empfehlungen, wie die der Weltgesundheitsorganisation und des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit, sollten Säuglinge und Kleinkinder möglichst keinerlei Bildschirmmedien nutzen. Insbesondere der Medienkonsum am Abend wird vielfach kritisch gesehen.

Die Kinder sind nicht schlechter eingeschlafen, nachdem sie den Film gesehen hatten.
„Nach unserer Studie, die durch ihren experimentellen Charakter im Zuhause der Kinder ziemlich einzigartig ist, können wir diese Befürchtung nicht uneingeschränkt teilen“, so Neele Hermesch. Ihre Kollegin Carolin Konrad ergänzt: „Wir haben auch nicht gesehen, dass sich der Schlaf in beiden Nächten voneinander unterschieden hätte. Es hätte ja auch sein können, dass die Melatoninwerte zwar gleich sind, die Schlafqualität aber unterschiedlich. Doch dem war nicht so, die Kinder sind zum Beispiel nicht schlechter eingeschlafen, nachdem sie den Film gesehen hatten.“ Wichtig ist den Forscherinnen jedoch zu betonen, dass es hierbei natürlich auch stark auf die Art des Films und die Dauer des Anschauens ankommen könnte. Auch ob die Eltern mitschauen oder nicht, könnte Auswirkungen haben. Denn neben möglichen Konsequenzen für das Melatonin könnten Bildschirmmedien auch anders den Schlaf beeinflussen, zum Beispiel wenn Inhalte sehr aufregend sind und so verhindern, dass Kinder zur Ruhe kommen.
Die Wirkung von Tabletnutzung auf Lernen
Im Rahmen ihres Projektes führten die Entwicklungspsychologinnen auch noch eine weitere Studie durch: Hier stand nicht das Melatonin als möglicher erklärender Mechanismus im Vordergrund, stattdessen ging es darum, ob die Tabletnutzung vor dem Einschlafen über mehrere Tage den Schlaf und darüber auch das Lernen der Kinder beeinflusst. Schließlich kennen wir das alle: Übermüdet lernt es sich schlechter und wir sind auch weniger kreativ. Auch hierbei kam am Abend zuvor die Geschichte von Peppa Wutz als Film oder als Buch zum Einsatz. Am Morgen danach bekamen die Kinder spezielle Spielzeuge, mit denen die Faktoren Kreativität und Lernen abgefragt werden konnten. Und auch hier machten die Forscherinnen eine Beobachtung, die wahrscheinlich viele Eltern beruhigen dürfte: „Wir haben bisher keine überzeugenden Belege gefunden, dass der Schlaf oder das Lernen durch den Film beeinträchtigt wurden. Allerdings haben wir die Daten noch nicht vollständig ausgewertet, die Ergebnisse sind also als vorläufig zu betrachten“, so Sabine Seehagen.
Und wie geht es nun weiter? „Wünschenswert sind weitere Studien im natürlichen Umfeld, also bei Familien zuhause, denn wir wissen, dass Kinder dort auch in den Abendstunden verschiedenen hellen Lichtquellen ausgesetzt sind, abgesehen von Bildschirmen. Und wir wissen auch, dass es entscheidend für den Anstieg des Melatonins am Abend sein kann, wie viel natürliches Tageslicht man über den Tag verteilt ausgesetzt war. Man sollte also den zukünftigen Studien den Einfluss verschiedener Lichtquellen im Alltag im Blick behalten, um den Effekt von Bildschirmen realistisch einordnen zu können. Zudem könnte man die Dauer der Bildschirmnutzung variieren. Abschließend ist zu erwähnen, dass wir uns in dieser Studie die Tabletnutzung an einem Abend angesehen haben. Wir können damit keine Aussage machen, ob regelmäßige Tabletnutzung in den Abendstunden den Beginn der Melatoninausschüttung verschiebt. Es wäre spannend zu sehen, ob weitere Studien unter Alltagsbedingungen zu den gleichen Ergebnissen kämen, denn wie gesagt wurden solche Untersuchungen bisher nur unter Laborbedingungen durchgeführt“, so Neele Hermesch.