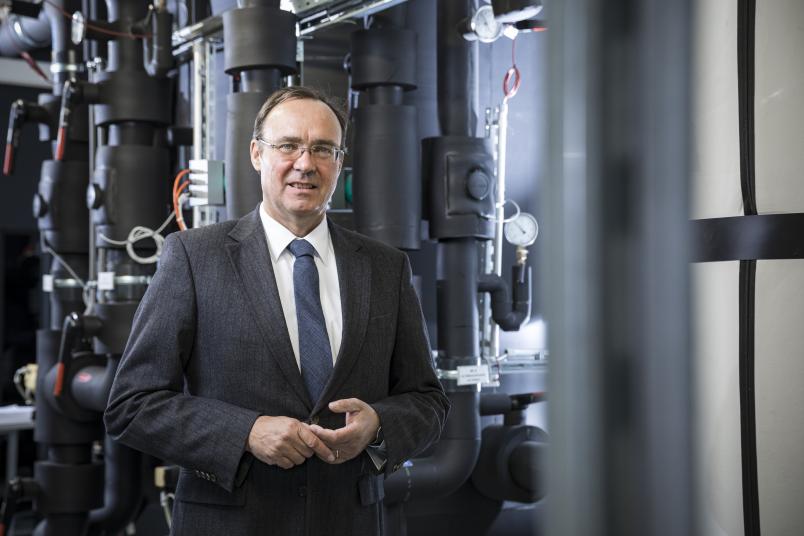
Maschinenbau
Rolf Bracke verheiratet Ingenieur- und Geowissenschaften
Erdwärme soll schon bald die Heizenergie aus fossilen Quellen ersetzen. Dafür müssen Maschinenbau und Geologie an einem Strang ziehen.
Fossile Energieträger haben keine Zukunft: Bis 2038 soll in Deutschland keine Kohle mehr verbrannt werden, bis 2050 auch kein Erdgas mehr. Erneuerbare Energiequellen sollen sie ersetzen, für den Wärmesektor heißt das vor allem Erdwärme. Auf diesem Gebiet ist Prof. Dr. Rolf Bracke Spezialist. Zum 1. Mai 2020 hat er an der RUB den neuen Lehrstuhl für Geothermische Energiesysteme an der Fakultät für Maschinenbau übernommen. Zudem ist er Leiter der ebenfalls noch neuen Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, kurz IEG, die Anfang 2020 ihre Arbeit aufgenommen hat und zu der seitdem auch das Internationale Geothermiezentrum Bochum gehört.
Grubenwasser kann Wärme liefern
„Deutschland verfügt über eine gigantische Fernwärmeinfrastruktur, die heute mit Wärme aus der Stein- und Braunkohleverbrennung, Abwärme aus der Stahlindustrie und zu einem kleineren Teil aus der Müllverbrennung gespeist wird“, erklärt Rolf Bracke. Wenn die Kohleverbrennung wegfällt und immer mehr Müll recycelt wird, müssen für die Wärme neue Quellen genutzt werden, und zwar schon in etwa 15 Jahren. Tiefe Erdwärme und – besonders im Ruhrgebiet – die Wärme der Grubenwässer kommen dafür infrage.
Nach der Stilllegung der Zechen wurden die Pumpen abgestellt und die alten Bergwerke sind mit Grundwasser geflutet, das sich aufgrund der Tiefe erwärmt. „Die neuen Gebäude auf Mark 51°7 zum Beispiel stehen über der ehemaligen Zeche Dannenbaum, die bis in die 1950er-Jahre eine der größten Zechen im Ruhrgebiet war“, so Bracke. In 900 Metern Tiefe ist das Wasser knapp 40 Grad warm. Wärmepumpen erhöhen diese Temperatur auf rund 50 Grad, sodass der neue Stadtteil damit beheizt werden kann. Und noch besser: Wenn es im Sommer warm ist und die gut gedämmten Gebäude sich aufheizen, können sie ihre Wärme auch wieder an das Fernwärmenetz abgeben. Das funktioniert über eine zweite Bohrung in etwa 300 Metern Tiefe, wo das Wasser nur 16 bis 18 Grad hat. Auf 12 Grad heruntergekühlt kann es die Gebäude klimatisieren.
Neue Bohrtechniken und Wärmepumpen
Die Herausforderungen an die Forschung liegen unter anderem darin, neue Bohrverfahren zu entwickeln, die es erlauben, schnell und sicher bis in vier oder fünf Kilometer Tiefe vorzudringen. „Wir arbeiten zum Beispiel mit Druckwasser-, Laser- oder Plasmatechnik“, sagt Rolf Bracke. Auch die technischen Anwendungen rund um die Nutzung der Tiefenwärme müssen weiterentwickelt werden. Da geht es etwa um Hochtemperaturwärmepumpen. „Man muss sich bewusstmachen, dass die heutigen Erzeuger für Fernwärme Kohlenwasserstoffe um die 600 Grad verbrennen, wovon die meiste Wärme übrigens gar nicht genutzt werden kann und daher verpufft. Die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger muss bedarfsgerecht erfolgen. Für den Betrieb bestehender Fernwärmenetze werden vielleicht 100 Grad gebraucht. Grubenwasser ist aber nur 40 Grad warm und muss für die bestehende Infrastruktur aufgeheizt werden. Hier sind komplexe dynamische Wechselwirkungen zwischen der Geosphäre und der Energietechnik zu beachten“, gibt der Forscher zu bedenken.






