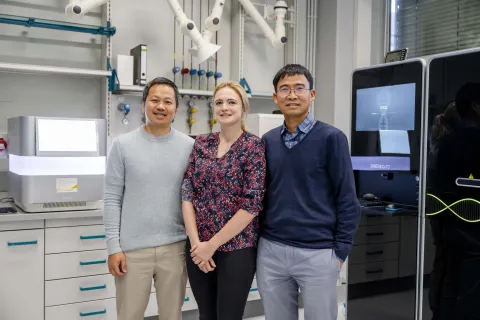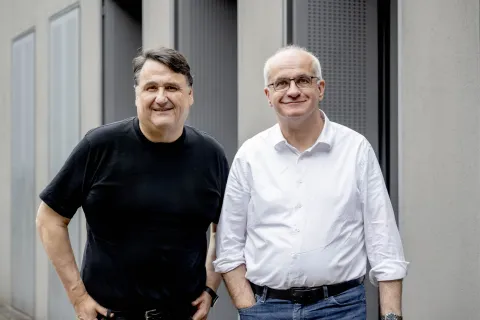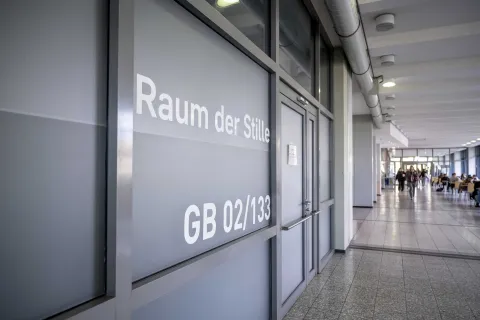Wissenschaftsgeschichte
Wie es wirklich zu Klonschaf Dolly kam
Im Rückblick sieht es so aus, als wäre die Gewinnung neuen Wissens ein zielgerichteter Prozess. Dass das nicht stimmt, kann Christina Brandt an vielen Beispielen belegen. Eines davon ist die Geschichte des Klonens.
Als 1996 das Klonschaf Dolly geboren wurde, war das Klonen in aller Munde. Öffentlich schien es, als sei die Geburt des prominenten Säugetierklons das i-Tüpfelchen auf jahrzehntelanger Vorarbeit der Forscher, die nun am vorläufigen Ziel ihrer Pläne angelangt waren. Wie es wirklich zum Klonschaf kam, hat Prof. Dr. Christina Brandt im Detail untersucht. Die Wissenschaftshistorikerin, die der Mercator-Forschergruppe „Räume anthropologischen Wissens“ an der Ruhr-Universität Bochum angehört, vollzieht die Entstehung von Wissen in den Lebenswissenschaften nach. Ihr Fazit: Wissen entsteht vollkommen unvorhersehbar.
Wie eine Detektivin
Wissenschaftliche Veröffentlichungen, Nachlässe verstorbener Forscher, Notizen aus der Arbeit im Labor, Zeitzeugeninterviews, Zeitungsartikel, Vorträge von Tagungen sind die Quellen von Christina Brandt. Wie eine Detektivin schlüpft sie in die Haut der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ergründet ihre Netzwerke, versucht jedes einzelne Detail ihrer Experimente nachzuvollziehen.
Äpfel waren die ersten Klone
Im Falle des Klonens geht die Geschichte zurück bis an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals ging es um die ungeschlechtliche Erzeugung von Pflanzen. Äpfel waren die ersten Klone. Erst viel später griffen Wissenschaftler anderer Disziplinen die Technik für andere Zwecke wieder auf und entwickelten sie weiter. Embryologen nutzten sie für ihre Grundlagenforschung. Und wieder andere kamen 30 Jahre später darauf zurück und erzeugten Dolly.
Ein ethisches Problem
Große zeitliche Lücken und das Überschreiten von Disziplinengrenzen sind in der Wissenschaftsgeschichte typisch. „Man kann nie wissen, wofür etwas, das jemand zu einem bestimmten Zweck entwickelt, einmal genutzt werden wird. Das ist natürlich auch ein ethisches Problem“, so Christina Brandt. Unzählige Faktoren und Zufälle haben einen Einfluss auf die Wissensentstehung. „Gewissheiten, die wir heute zu haben meinen, können in ein paar Jahrzehnten schon längst wieder revidiert oder gar überholt sein“, sagt die Forscherin.