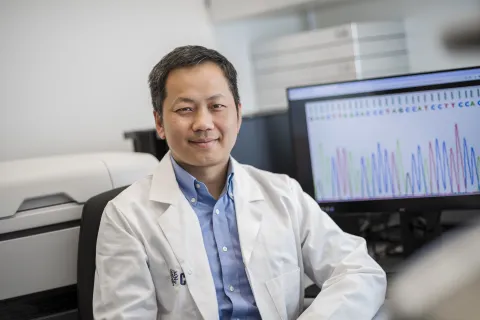Neurologie
Früh behandelt ist halb gewonnen
Das Wissen um die genaue Entstehung von neurologischen Erkrankungen ist essenziell für die Entwicklung von Therapien. Neue Erkenntnisse könnten Ansätze für effektivere Diagnose- und Therapiestrategien liefern.
Neurologische Erkrankungen beginnen oft mit einem Entzündungsgeschehen und dem Abbau der sogenannten Myelinschicht, welche die Nervenfasern (Axone) wie eine schützende Isolierschicht umgibt. Daraufhin folgt meist die gefürchtete Schädigung der Nervenfasern (axonale Neurodegeneration). Von nun an tickt die Uhr: Denn während das Entzündungsgeschehen im Frühstadium neurologischer Erkrankungen noch gut behandelbar ist, schlagen entsprechende Therapien in späteren Stadien häufig nicht mehr ausreichend an.
Zwei Arbeitsgruppen um Dr. Ilya Ayzenberg sowie Dr. Ruth Schneider aus der Universitätsklinik für Neurologie (Prof. Dr. Ralf Gold) und dem Institut für Neuroradiologie (Prof. Dr. Carsten Lukas) des St. Josef Hospitals Bochum haben sich mit dem Zusammenspiel dieses Dreischritts aus Entzündungen, dem Abbau des Myelins und der meist irreversiblen axonalen Neurodegeneration beschäftigt. Ihre Ergebnisse konnten sie im März und Juni 2022 in den renommierten Fachzeitschriften Brain und Brain Communications veröffentlichen.
Auf der Spur des geheimnisvollen IgLON5-Syndroms
Der Arbeitsgruppe um Ilya Ayzenberg gelang es erstmals, Belege für eine primär entzündliche Ursache des sogenannten IgLON5-Syndroms in einer großen Patientenkohorte nachzuweisen. Es handelt sich dabei um eine 2014 zum ersten Mal beschriebene, seltene Erkrankung des höheren Alters, bei welcher es zu Schlaf- und Bewegungsstörungen sowie Hirnstammsymptomen wie Schluckstörungen kommen kann. In vielen Fällen führt die Erkrankung unbehandelt zum Tod der Betroffenen.
Die Entstehungsmechanismen wirken auf den ersten Blick widersprüchlich: Einerseits wurde beim IgLON5-Syndrom eine Ablagerung von potenziell schädlichen TAU-Proteinen nachgewiesen – ähnlich wie bei klassischen neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer-Demenz. Andererseits deutet die Bildung von Autoantikörpern, welche sich gegen das Oberflächenprotein IgLON5 richten, auf autoimmun-entzündliche Mechanismen hin. Die Forschungsgruppe führte eine detaillierte Analyse der Frühphase des IgLON5-Syndroms durch. Dazu rekrutierten die Forschenden mehr als 50 Patienten aus einem deutschlandweiten Netzwerk für autoimmune Hirnentzündungen (GENERATE). „Auf so eine Anzahl von Studienteilnehmenden zu kommen ist aufgrund der Seltenheit der Erkrankung bereits eine kleine Sensation, die auch nur durch die Unterstützung eines landesweiten Konsortiums möglich war“, so Ilya Ayzenberg.
Häufig erhalten Betroffene ihre Diagnose erst sehr spät. „In unserer Kohorte konnten wir jedoch Patient*innen mit kurzem Krankheitsverlauf analysieren und haben unerwartet in Frühstadien der Erkrankung entzündliche Veränderungen im Hirnwasser nachweisen können“, erklärt Ilya Ayzenberg. Im Frühstadium der Erkrankung sprachen Betroffene gut auf eine entzündungshemmende Therapie an, was auch die nachfolgende Neurodegeneration verhinderte. Im Spätstadium der Erkrankung waren die Neurodegenerationsmarker im Blut hingegen deutlich erhöht und die Therapie war nicht mehr wirksam. „Es scheint, dass die Erkrankung in zwei Stadien verläuft: zunächst eine Antikörper-vermittelte körpereigene Entzündung, dann ein Abbau von Nervenzellen. Eine frühe Therapie ist entscheidend um diese Kaskade zu verhindern“, folgert Dr. Thomas Grüter, der Erstautor der Studie.
Nervenverlust verhindern: ein Wettlauf gegen die Zeit
Auch bei sehr viel häufigeren Autoimmun-Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose ist die Interaktion von entzündlichen und neurodegenerativen Prozessen entscheidend dafür, ob und wann eine Therapie wirksam ist. Die Myelinschicht spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Ihr Verlust (Demyelinisierung) führt zu strukturellen Nervenschädigungen und zu einem irreparablen Verlust von Nervenfasern. „Eine Langzeitimmuntherapie greift daher umso effektiver, je früher die Therapie beginnt – sie wirkt anti-entzündlich und beugt dem Myelinverlust vor. Die in der Folge auftretende axonale Degeneration ist therapeutisch viel schwieriger zu beeinflussen“, sagt Ruth Schneider. „An Therapien, die einen Wiederaufbau des Myelins bewirken, wird aktuell noch geforscht, zumeist an Tiermodellen.“
Das Problem der Quantifizierung des Myelingehalts im Gehirn
„Ein zentrales Problem der Humanmedizin besteht darin, Therapieerfolge wie die Remyelinisierung beim lebenden Patienten ohne Gewebsschnitte wie im Tiermodell zu bestimmten“, so Ruth Schneider. Der Neurologin und ihrer Kollegin Britta Matusche aus der Neuroradiologie ist es nun erstmals gelungen, mittels Magnetresonanztomografie die Remyelinisierung, also die Neubildung der Myelinscheiden, in vivo beim Menschen abzubilden.
Untersucht wurden eine Patientin sowie zwei ihrer Cousins mit einer sehr seltenen genetischen Erkrankung, welche zu einem Stoffwechseldefekt führt. Dieser sogenannte Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase-Mangel führt zum Abbau der Myelinschicht der Gehirnzellen, was meist mit schweren kognitiven Einbußen, spastischen Lähmungen und einem vollständigen Verlust der Sehfähigkeit einhergehen kann. Die MRT-Sequenzen der Betroffenen wurden verglichen mit denen von 14 gleichaltrigen gesunden Personen.
„Mittels einer synthetischen MRT-Sequenz konnten wir den Wiederaufbau von Myelin im Gehirn beim Menschen in vivo nach der Therapie mit den fehlenden Stoffwechselprodukten messbar nachweisen“, erklärt Ruth Schneider. „Damit haben wir nun eine wichtige Methode zur Hand, um den Erfolg von neuen Therapien im Hinblick auf die Remyelinisierung bei Erkrankten nachzuweisen.“
Das langfristige Ziel des Forschungsteams ist es, entsprechende MRT-Messungen nicht nur bei seltenen Stoffwechselerkrankungen einzusetzen, sondern auch bei häufigeren Erkrankungen, bei denen Medikamente eine Remyelinisierung bezwecken sollen, etwa der Multiplen Sklerose.