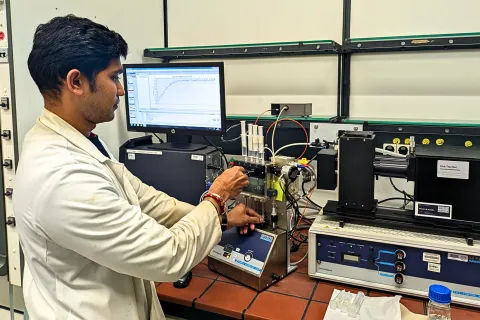Selvapravin Kumaran, Doktorand in der Arbeitsgruppe Mikrobielle Biotechnologie, nimmt eine Messung im Labor vor.
Biotechnologie
Giftiges Styroloxid in attraktive Verbindung umwandeln
Die Styroloxid-Isomerase entpuppt sich als multifunktioneller Helfer für die Biotechnologie.
Das Bakterien-Membranenzym Styroloxid-Isomerase kann giftige Verbindungen in Wertstoffe verwandeln. Wie genau es das macht, hat Selvapravin Kumaran, Doktorand in der Arbeitsgruppe Mikrobielle Biotechnologie der Ruhr-Universität Bochum von Prof. Dr. Dirk Tischler, herausgefunden. Diese Erkenntnisse könnten künftig helfen, das multifunktionelle Enzym in weiteren Reaktionen einzusetzen, bei denen es darum geht, industriell attraktive Verbindungen aus günstigen Vorläufern herzustellen. „Enzyme sind ein mächtiges Werkzeug, das unser Leben umweltfreundlicher gestalten kann“, sagt Dirk Tischler. Die Forschenden berichten in der Fachzeitschrift ACS Catalysis vom 29. September 2025.
Ein Enzym mit bisher unerforschtem Mechanismus
Die bakterielle Styroloxid-Isomerase ist der Wissenschaft seit über drei Jahrzehnten bekannt, doch ihr Wirkmechanismus wurde bislang nicht aufgeklärt. „Die Arbeit mit diesem Enzym ist schwierig, da es in der Membran des bakteriellen Zellsystems verankert ist“, sagt Dirk Tischler. Sein Team konnte in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Delft die Rolle der Aminosäure Tyrosin bei der Umwandlung des toxischen Styroloxids durch die seltene Meinwald-Umlagerung aufdecken.
Präzise abgestimmte Architektur des Enzyms
In früheren Arbeiten zur Struktur zeigte sich, dass das Enzym ein Eisen-haltiges Häm enthält, das die Reaktion vorantreibt. In der aktuellen Studie berichten die Forschenden, dass das Enzym eine sehr strenge Architektur aufweist, bestehend aus dem Eisen-haltigen Häm und zwei Aminosäuren – Tyrosin und Asparagin –, die präzise positioniert sind, um die Reaktion zu ermöglichen. Durch den Austausch dieser Aminosäuren und den Einsatz moderner biochemischer Methoden konnte das Team zeigen, dass die funktionelle Gruppe des Tyrosins eine entscheidende Rolle bei der Umlagerung des Substrats spielt.
„Dieses winzige Enzym nutzt die seltene Chemie der Meinwald-Umlagerung, um selektiv Phenylacetaldehyd zu erzeugen – gesteuert durch die Architektur seines aktiven Zentrums“, erklärt Dirk Tischler. „Bislang war die katalytische Rolle der Styroloxid-Isomerase nur eine Hypothese. Unsere Arbeit liefert den ersten experimentellen Beweis dafür, wie dieses Enzym auf molekularer Ebene funktioniert“, sagt Selvapravin Kumaran, Erstautor der Arbeit.
Enzymatische Vielseitigkeit
Das Verständnis des katalytischen Mechanismus führte die Forschenden zur Entdeckung weiterer Potenziale dieses Enzyms. Die Styroloxid-Isomerase kann auch für andere Zwecke eingesetzt werden, ähnlich wie Enzyme, die in der Textilindustrie zum Bleichen von Farbstoffen verwendet werden. So kann sie potenziell Wasserstoffperoxid entgiften und zudem direkt aus Styrol – dem Vorläufer von Styroloxid im bakteriellen Styrolabbau – das wertvolle Produkt Phenylacetaldehyd herstellen.
Auch wenn diese zusätzlichen Aktivitäten derzeit noch vergleichsweise ineffizient sind, könnte die Multifunktionalität des Enzyms künftig genutzt werden, um es gezielt für industrielle Anwendungen weiterzuentwickeln und hochwertige Produkte aus preiswerten Substraten wie Styrol herzustellen. „Das Potenzial dieses Enzyms geht weit über die Produktion von Phenylacetaldehyd hinaus – es könnte eine Vielzahl verschiedener Reaktionen antreiben. Deshalb werden wir seine Möglichkeiten weiter erforschen“, plant Dirk Tischler.