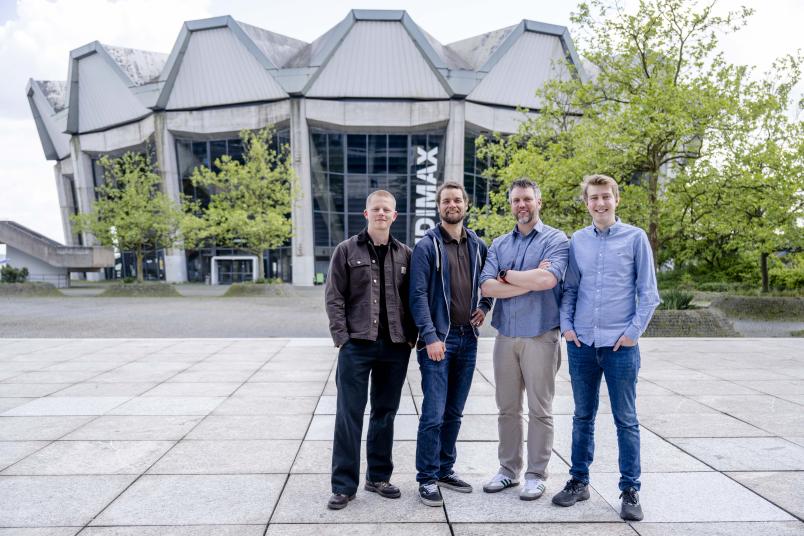Algorithmen für Hörgeräte
Wenn Oma abschaltet
Hörgeräte sollen erwünschte Geräuschquellen erkennen und unerwünschten Schall aus dem Signal herausrechnen. Flexibel und in Echtzeit.
Fast jeder hat einen Verwandten, der bei Familientreffen leicht den Anschluss verliert und irgendwann im Gespräch abschaltet: 13 bis 15 Prozent der Deutschen sind schwerhörig. Gerade in großer Runde, bei vielen Geräuschquellen, bei Nebengeräuschen wie im Straßenverkehr oder Hall, etwa im Treppenhaus oder in der Kirche, fällt es Betroffenen besonders schwer, einem Gespräch zu folgen.
Hörgeräte verstärken oft auch unerwünschte Geräusche
Hörgeräte können zwar helfen, aber nur in begrenzter Weise. Denn da sie den Schall verstärken, sodass der Träger ihn besser wahrnehmen kann, verstärken sie sowohl erwünschten als auch unerwünschten Schall. Die erwähnten Nebengeräusche oder Raumhall sind auch für sie problematisch.
Forscher am Institut für Kommunikationsakustik der Ruhr-Universität um Prof. Dr. Rainer Martin arbeiten daran, Hörgeräte und andere akustische Technik wie etwa die Sprachqualität von Telefonen zu verbessern.
„Es geht darum, störende Einflüsse aus dem Signal herauszurechnen“, sagt Rainer Martin, „das heißt, wir müssen das Gerät dazu bringen, eine Zielquelle zu identifizieren und zu verstärken und den ganzen Rest auszublenden.“
Technik muss in Echtzeit funktionieren
Was das Ganze nicht einfacher macht: Das muss sehr schnell gehen, nämlich in Echtzeit, damit der Hörgeräteträger keine Verzögerung wahrnimmt. Es stehen also nur Millisekunden für komplizierte Rechenverfahren zur Verfügung, die die Ingenieure stetig weiterentwickeln.
Ihr tägliches Handwerkszeug sind Algorithmen, also Rechenverfahren, die auf der statistischen Struktur der Signale basieren. Mehrere Algorithmen müssen miteinander kooperieren, damit das Hörgerät erkennt, ob es sich bei dem zu verstärkenden Klang zum Beispiel um Sprache, um Musik oder eben nur um Geräusche handelt. „Das Gerät soll sich selbstständig an die Hörsituation anpassen, der Nutzer soll ja nicht ständig von Hand umschalten müssen“, erklärt Rainer Martin.
[infobox: 1]
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Lehrstuhls sind an verschiedenen Projekten beteiligt, deren Ziel die Verbesserung von Hörgeräten und anderen Hörhilfen ist. Dazu gehört zum Beispiel das Cochlea-Implantat, das es ertaubten Menschen erlaubt, einen Höreindruck zu erlangen, sofern ihr Hörnerv intakt ist.
Um die Verbesserung dieser Technik geht es auch im Sonderforschungsbereich 823 „Statistik nichtlinearer dynamischer Prozesse“ (Sprecherhochschule: Technische Universität Dortmund) und im EU-Marie-Curie-Initial-Training-Network „I Can Hear“, das der Lehrstuhl koordiniert.