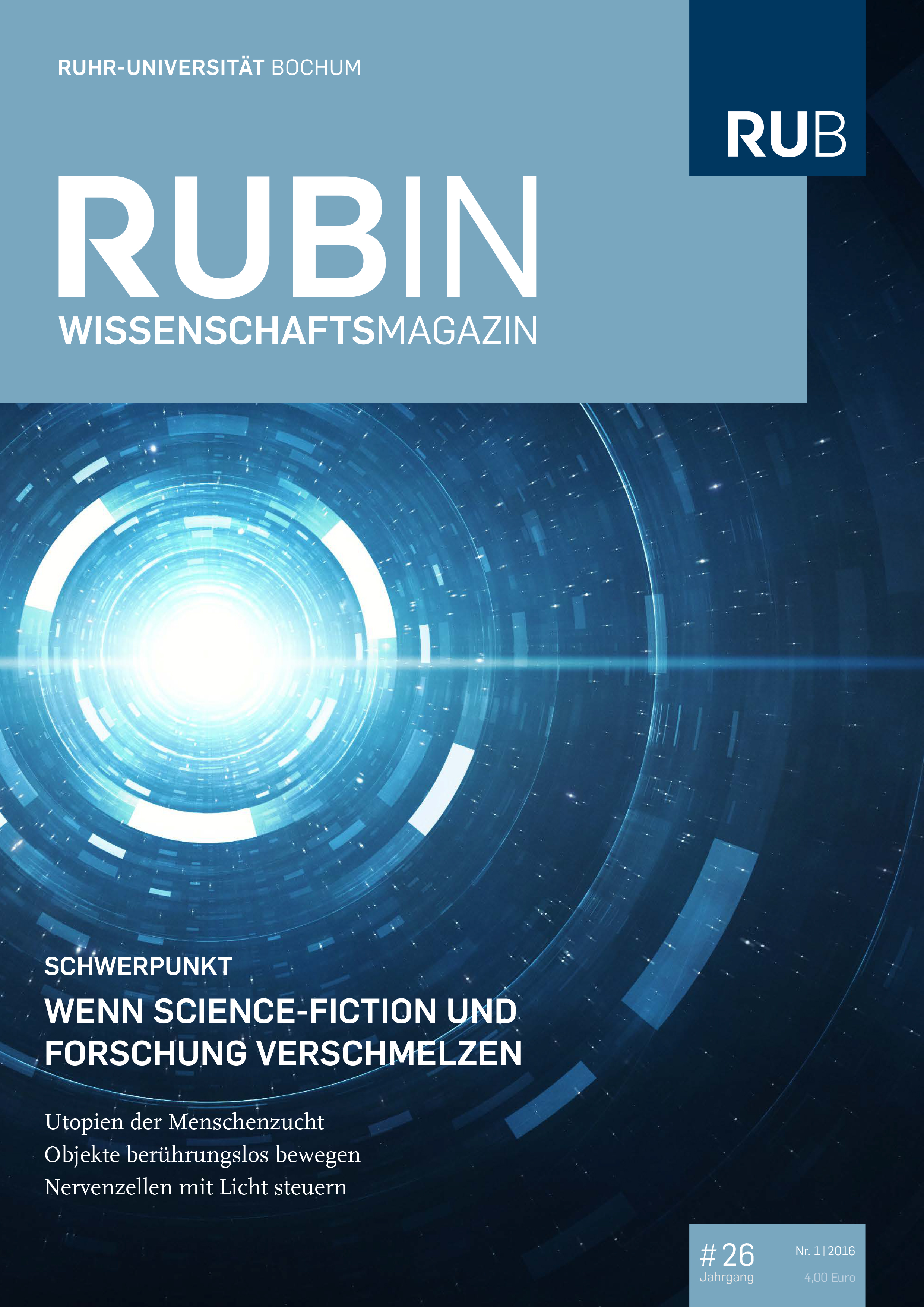Frühe Neuzeit
Menschenzucht ohne Gentechnik
Die Idee, Menschen zu verbessern und die Fortpflanzung zu optimieren, ist nicht erst mit der Gentechnik aufgekommen. Schon im 18. Jahrhundert gab es Konzepte dafür, die aus heutiger Sicht undenkbar scheinen.
Eine Welt ohne Gewalt und ohne echte Emotionen, in der Kinder nicht mehr geboren, sondern im Labor produziert werden, um ihre Aufgaben in einer von fünf gesellschaftlichen Kasten perfekt erfüllen zu können: In seinem berühmten Science-Fiction-Roman „Schöne neue Welt“ zeichnet Aldous Huxley 1932 eine düstere Vision für die Zukunft.
Utopien für die Menschenzucht gab es allerdings schon viel früher, noch bevor die Gentechnik auf den Plan trat. Und zwar nicht nur in Form von Science-Fiction-Romanen, sondern als Bestandteil eines medizinischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Diskurses im 18. Jahrhundert.
Diese Utopien erforscht Prof. Dr. Maren Lorenz vom Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit und Geschlechtergeschichte. Bisherige Studien konzentrierten sich auf das ausgehende 19. Jahrhundert und spätere Jahre. Viele der früheren Quellen zu diesem Thema haben sich noch kein Historiker und keine Historikerin angesehen – vor allem nicht die deutschen Texte. Dabei kamen mit der Aufklärung zahlreiche Konzepte für die „Verbesserung des Menschengeschlechtes“ auf.

„Man suchet das Vieh auf alle Art zu vermehren, man errichtet Stutereyen, Holländereyen, Schäfereyen und dergleichen. Warum sollte man auch nicht Menschereyen anrichten, die einen viel grössern Werth haben, und warum sollte man nicht den Ausschweifungen in der Wollust eine solche Ordnung zu geben versuchen, daß dadurch die Vermehrung der Menschen in der That befördert wird?“, hieß es zum Beispiel 1769 bei Johann Heinrich Gottlob von Justi, einem berühmten politischen und ökonomischen Denker.
Bevölkerung als wirtschaftliche Ressource
Mit der Aufklärung gewann die Medizin an Macht, und Ökonomen und Verwaltungswissenschaftler erkannten die Bevölkerung als wirtschaftliche Ressource, die sie vermehren wollten. „Jede Regierung wollte sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen der wirtschaftlichen Macht sichern“, erklärt Professor Lorenz. „Die Idee vom Wachstum gab es noch nicht, der Kuchen schien begrenzt. Man musste also stärker sein als die anderen.“
Ende des 18. Jahrhunderts publizierten deutsche Mediziner in aufklärerischen Magazinen und dickleibigen Trakten der „Medizinialpolicey“, dass eine bessere Bevölkerung nicht allein durch Quantität erzielt werden könne, sondern dass es auf Qualität ankomme. Wie kann man möglichst intelligente Menschen produzieren? Wie die Ehe optimieren?
Die Autoren dachten nicht nur über Hygiene und bessere Säuglingspflege nach, sondern auch über eine gezielte Fortpflanzungspolitik, um eine starke und gesunde Bevölkerung zu schaffen, zum Beispiel für eine effiziente Agrarproduktion und ein schlagkräftiges Militär.
Ehe auf Probe und Zwangsscheidung
Im deutsch-französischen Diskurs empfahlen Mediziner ihren Territorialregierungen, zum Beispiel die Ehe auf Probe einzuführen und eine Zwangsscheidung, falls Paare keine Nachkommen hervorbrächten – selbst wenn sie aus Liebe zusammenbleiben wollten. Auch Ledigensteuern, teilweise schon aus dem Mittelalter bekannt, waren wieder im Gespräch.
„Sie dachten ethisch relativ revolutionär, und das in einem Zeitalter, in dem eigentlich massive Zensur herrschte“, weiß Maren Lorenz. Einige forderten sogar, das Zölibat abzuschaffen, weil traditionell nur körperlich und geistig fitte Männer in den katholischen Kirchendienst treten durften – eine Verschwendung im Hinblick auf die Fortpflanzung.

Eigentlich hätte ein Aufschrei durch die christlichen Kirchen gehen müssen.
Maren Lorenz
„Es war eine rein ökonomisch-pragmatische Diskussion, die teilweise im Widerspruch zum religiösen Menschenbild stand“, so Lorenz. „Eigentlich hätte ein Aufschrei durch die christlichen Kirchen gehen müssen.“ Ob es dazu kam, möchte die Bochumer Historikerin noch herausfinden, indem sie auch theologische Quellen in ihre Recherche einbezieht.
Viele Ideen, die in Deutschland seit Mitte des 18. Jahrhunderts Anklang fanden, stammten ursprünglich aus Frankreich. Dort publizierten Ärzte und Chirurgen – so fand Lorenz heraus – gezielt in den neuen ökonomischen Journalen.
Menschenzuchts-Hype in den USA
Als der Hype um die Menschenzucht in Europa schon wieder abebbte, nahm er in Amerika erst richtig Fahrt auf. Zuchtkonzepte verbanden sich dort mit der Phrenologie, die versuchte, Zusammenhänge zwischen Charaktereigenschaften und der Form des Schädels herzustellen. Um 1850 fanden sich die Ideen in immer wieder neuen Auflagen von Eheratgebern, die sich hervorragend verkauften. Ende des 19. Jahrhunderts erließen die USA basierend auf diesen Zuchtideen zunehmend Einwanderungsgesetze, die zunächst den Chinesen den Zutritt verwehrten, dann den Italienern, Polen und Iren.
„Es hieß, diese Völker würden nicht arbeiten, die Polen und Iren würden nur saufen, die Italiener sich nur prügeln, und das täten die Iren und Polen auch“, zitiert Lorenz. Die Amerikaner versuchten, dieses Verhalten aufgrund von Gemeinsamkeiten der drei Völker zu erklären, und dafür kam für sie nur eine infrage: die katholische Religion.
„Solche Theorien wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Zeitschriften wie der New York Times diskutiert“, sagt die Historikerin. Sozioökonomische Theorien tauchten hingegen nur am Rande auf.
Konzepte für „Menschereyen“
Maren Lorenz interessiert sich für die Wege, die die Diskurse nahmen. So fand die Forscherin bei ihren Recherchen zum Beispiel heraus, dass es die Idee der nationalsozialistischen Lebensborn-Heime bereits in der Aufklärung gab. In diesen Heimen sollten SS-Leute mit blonden „Arierinnen“ „hochwertige Rassekinder“ zeugen.
„Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelten französische Mediziner konkrete Konzepte für solche ‚Menschereyen‘ – die dann in Deutschland begeistert von Ökonomen wie dem eingangs zitierten Justi aufgegriffen und sogar in literarischen Zeitschriften diskutiert wurden“, erzählt Maren Lorenz.
Das sollten öffentliche städtische Häuser für zwangseingewiesene ledige Frauen über 25 Jahren sein. Verheiratete und unverheiratete gesunde Männer sollten sie zwecks Fortpflanzung besuchen können – gegen eine Gebühr, die in die Stadtkasse fließen sollte. Die Kinder hätten dem Staat gehört.
„Der Nachwuchs sollte dort angesiedelt werden, wo ‚minderes Menschenmaterial‘ lebte oder wo es zu wenig Menschen gab“, beschreibt Lorenz das Konzept. Umgesetzt wurden diese Pläne auch in Frankreich nie. „Gerade Ökonomen fanden sie aber total interessant“, erklärt die Professorin.

Ikonen der Aufklärung sprachen von müßigen Kostgängern und krüppelhaften Ehestandsfrüchten, die man irgendwie loswerden müsse.
Maren Lorenz
Die sonst in der Aufklärung so zentrale Erziehung spielte in diesen Diskursen keine Rolle. Es ging nur um das Körperliche. Wie kann man Qualität erkennen? Welche Männer und Frauen muss man zusammenbringen, um optimale, auch intelligente Nachkommen zu erzeugen? Aber auch: Wie kann man verhindern, dass sich diejenigen fortpflanzen, die für „unbrauchbar“ erklärt werden?
Literaten und Ökonomen mischten sich in die medizinischen Debatten ein und brachten Ende des 18. Jahrhunderts zusätzlich die Armen ins Spiel, die der Gesellschaft ihrer Meinung nach unnütz auf der Tasche lagen. „Da sprechen Ikonen der Aufklärung von müßigen Kostgängern und krüppelhaften Ehestandsfrüchten, die man irgendwie loswerden müsse“, sagt Lorenz.
Die Armen der Hand Gottes überlassen
Die Impfung gegen Pocken, die Ärzte Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten, gefiel daher nicht jedem. Gerade Arme erkrankten daran, und genau die wollten manche lieber der Hand Gottes überlassen. Im französischen Journal Économique forderten einige Autoren sogar, „Krüppeleinheiten“ zu bilden, die bei kriegerischen Auseinandersetzungen gezielt verheizt werden könnten.
Was nach gruseligen Ideen aus der Vergangenheit klingt, ist für Maren Lorenz aber nicht bloß aufgearbeitete Historie. Häufig sieht sie in der modernen Gesellschaft Anknüpfungspunkte an die Utopien der Frühen Neuzeit, etwa bei der Pränataldiagnostik. Zu oft, so die Geisteswissenschaftlerin, stehe bei der Forschung nur die Machbarkeit im Vordergrund. Viel zu wenige befassten sich mit der Technologiefolgenabschätzung, den sozialen und ethischen Implikationen.