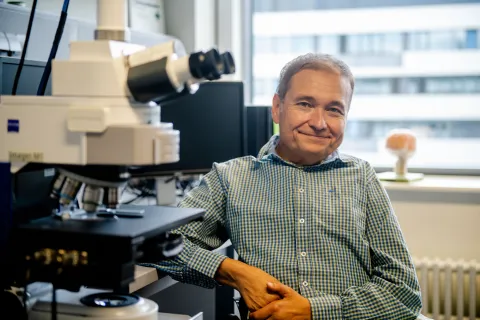Forschungsfonds Medizin
Projekte aus der ersten Förderphase starten
So stärkt das Land Nordrhein-Westfalen die Kooperation zwischen Bochum und Bielefeld.
Mit dem Forschungsfonds Medizin hat das Land Nordrhein-Westfalen die Zusammenarbeit der RUB-Unikliniken in Ostwestfalen-Lippe und der Universität Bielefeld gestärkt. Im April 2017 starten die ersten Projekte, die aus Mitteln des Fonds finanziert werden. Insgesamt fließen rund 500.000 Euro in fünf Forschungsvorhaben. Die Themen der neuen Kooperationen reichen von Herz- und Krebsforschung bis zu regenerativer Medizin.
Die Projekte aus der ersten Förderungsrunde befassen sich mit folgenden Themen:
Regenerative Medizin und Blutplasma
Stammzellen sind in der Lage, den Körper zu reparieren; dadurch lassen sich alle Organe regenerieren. Im Alter funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr, weil dem Körper die Wachstumsfaktoren der Jugend, also spezielle Proteine, fehlen. Mit diesem Aspekt befasst sich ein Projekt der Biologen Prof. Dr. Christian Kaltschmidt und Prof. Dr. Barbara Kaltschmidt von der Universität Bielefeld und Prof. Dr. Cornelius Knabbe vom Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen, einer Universitätsklinik der RUB. In ihrer Kooperation suchen die Wissenschaftler in menschlichem Blutplasma nach Wachstumsfaktoren, die humane adulte Stammzellen zur Vermehrung bringen und so alte Organe erneuern.
Herzmuskelschwäche
Mit Genmutationen, die sogenannte Kardiomyopathien auslösen, also Erkrankungen des Herzmuskels, befassen sich Prof. Dr. Dario Anselmetti von der Universität Bielefeld und Prof. Dr. Hendrik Milting vom Erich-und-Hanna Klessmann-Institut am Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Die Kardiomyopathie kann zum plötzlichen Herztod führen. Eine Mutation im Gen TMEM43 verursacht eine besonders aggressive Form einer Kardiomyopathie, die eine Herzrhythmusstörung begünstigt. Das Gen trägt die Information für die Herstellung des Proteins LUMA, das sich auch in Herzmuskelzellen findet. Die Funktion des Proteins in der Zelle ist bisher unbekannt. Die Wissenschaftler wollen erforschen, welcher molekulare Krankheitsmechanismus der Mutation zugrunde liegt.
Zwei Projekte zum Thema Krebs
In zwei Projekten werden die molekularen Grundlagen und die Diagnostik von Krebserkrankungen erforscht. Ein Projekt widmet sich der „Mycosis fungoides“, einem bösartigen Tumor, der in der Haut entsteht. Der Genetiker Prof. Dr. Jörn Kalinowski von der Universität Bielefeld kooperiert dafür mit Prof. Dr. Rudolf Stadler vom Johannes-Wesling-Klinikum Minden, einem Universitätsklinikum der RUB. Die Erkrankung zeigt sich zuerst meist in Form von Ekzemen, die sich nach Jahren zu Tumoren entwickeln können. Bislang gibt es in fortgeschrittenen Stadien für die Krankheit keine kurative Therapie. Kalinowski und Stadler analysieren die molekularen Grundlagen der Krankheit. Sie wollen feststellen, wie sich die Tumore dieser Krebsart in den Entwicklungsstadien der Mycosis fungoides genetisch verändern.
Im zweiten Projekt wird mit einem bildgebenden Verfahren untersucht, wie sich der Stoffwechsel von Gehirntumoren von dem des gesunden Gehirngewebes unterscheidet. Die Biologen Dr. Hanna Bednarz und Prof. Dr. Karsten Niehaus von der Universität Bielefeld leiten das Projekt zusammen mit Prof. Dr. Udo Kellner und Privatdozent Dr. Ulrich Knappe vom Johannes-Wesling-Klinikum Minden. Sie nutzen eine in Bielefeld entwickelte Methode der bildgebenden Massenspektrometrie, um Tumormarker zu erfassen. Tumormarker sind vom Körper gebildete Substanzen, die darauf hinweisen, ob eine Krebserkrankung vorliegt und welche Bereiche des Gewebes betroffen sind. Mit der Methode lassen sich mit molekularer Bildgebung besonders kleine Moleküle erfassen und auswerten. Ein Ziel des Projekts ist es, dieses Verfahren in die Diagnostik des Klinikalltages einzubinden.
Depression
Die Studie befasst sich damit, wie Bewegungstraining und Selbstinstruktionstraining auf Depression wirken. Selbstinstruktionen als Teil von Psychotherapie zielen auf die Veränderung des alltäglichen Verhaltens. Bewegungsprogramme können Symptome der Depression – etwa Antriebslosigkeit und Stimmungsschwankungen – verbessern. Sowohl körperliche Aktivität als auch Selbstinstruktionstraining führen dabei zu einer veränderten Hirnstruktur. Das neue Projekt untersucht, wie sich die Effekte beider Interventionen auf das Gehirn unterscheiden. Prof. Dr. Thomas Schack von der Universität Bielefeld kooperiert für das Vorhaben mit Privatdozentin Dr. Karin Rosenkranz und Prof. Dr. Hans-Udo Schneider von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Lübbecke.