
Interview
Abgeschottet von den angrenzenden Disziplinen
Die Mathematik ist zum Herzstück der modernen Ökonomie geworden. Manche feiern das als Fortschritt. Andere warnen, es grenze das Denken ein.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die vorherrschende Sprache in der Volkswirtschaftslehre die Mathematik. Wer in den angesagten Fachzeitschriften publizieren will, muss sich an eine Formelsprache halten. Das trägt dazu bei, dass sich das Fach von anderen Sozialwissenschaften abschottet. Prof. Dr. Michael Roos plädiert: Die Ökonomie sollte sich angrenzenden Fachbereichen gegenüber wieder mehr öffnen und auch in natürlicher Sprache kommunizieren (siehe Kommentar).
Herr Roos, woher kommt die Formelverliebtheit der modernen Ökonomen?
Früher konnte man Forschungsaufsätze in natürlicher Sprache verfassen. Heute besteht ein Großteil einer Publikation aus Formeln, und das wird von vielen als Fortschritt empfunden. Die Volkswirtschaftslehre orientiert sich an der Naturwissenschaft, vor allem die Physik war immer das große Vorbild. Viele sehen in der formalisierten Sprache den Unterschied zwischen einer wahren Wissenschaft und einer Protowissenschaft. Diese Mathematisierung ist wichtig für das Selbstbild der Ökonomen.
Ist die Mathematisierung denn nicht auch nützlich?
Ja, in vielen Fällen sind Gleichungen und grafische Darstellungen ein sinnvolles Handwerkszeug. Aber manche Bereiche werden durch die Fokussierung auf die Mathematik unsichtbar. Über bestimmte Themen kann man besser in natürlicher Sprache nachdenken. Ein anderes wichtiges Handwerkszeug, das uns zur Verfügung steht, sind Computersimulationen. Die algorithmische Programmiersprache ist sozusagen ein Zwischending zwischen der sehr abstrakten Sprache der Mathematik und der natürlichen Sprache. Auf jeden Fall denke ich, wir sollten nicht ausschließlich in Formeln kommunizieren.

Es gibt eine starke Intoleranz gegenüber diesem Denken.
Spüren Sie Gegenwind von Ihren Kollegen wegen Ihrer Einstellung?
Es gibt eine starke Intoleranz gegenüber diesem Denken. Ich gehe schon das Risiko ein, mich aus der Community herauszukatapultieren. Natürlich bin ich heute in einer Position, in der mir keiner mehr etwas kann. Ich habe eine feste Stelle. Meines Erachtens bin ich genau deshalb aber in der Verantwortung, diese Freiheit zu nutzen. Es ist mir wichtig, mich für diese Dinge einzusetzen.
Und früher?
Als Postdoc habe ich mehr darüber nachgedacht. Eine akademische Karriere einzuschlagen, ist generell risikoreich. Mich als Makroökonom der Psychologie zuzuwenden war aber hochgradig riskant. Mir war es das wert. Es war eine Gewissensentscheidung. Ich habe mir gesagt, entweder es funktioniert auf diese Weise oder es ist nicht das Richtige für mich. Ich wollte keinen Kompromiss eingehen und mir über Jahre Methoden aneignen, die mich nicht überzeugen. Zum Glück hat es funktioniert, es hätte aber auch schiefgehen können.

Was geben Sie den Nachwuchsforschern an Ihrem Lehrstuhl in der Hinsicht mit?
Ich finde es wichtig, dass Nachwuchsforscher Vorbilder haben, die zeigen, dass es nicht nur den Mainstream-Weg gibt. Ich lebe meinen Doktoranden das natürlich vor. Aber ich sage ihnen auch, dass es riskant ist, dass wir in der Minderheit sind. Ohne Mathematik können sie in den Top-Zeitschriften schließlich nicht veröffentlichen, und diese Publikationen sind später entscheidend für Berufungen. Sie akzeptieren das.
Gibt es international noch mehr Wissenschaftler, die Kritik an der allzu formalisierten Volkswirtschaftslehre üben?
Der Widerstand ging ursprünglich von den Studierenden aus. Im Jahr 2000 organisierten sich französische Studierende als Gruppe der postautistischen Ökonomen. Die Bewegung breitete sich international aus, in Deutschland gibt es zum Beispiel das Netzwerk Plurale Ökonomik. Die Studierenden sehen große Probleme in der Welt, zu denen die Volkswirtschaftslehre etwas beitragen könnte – aber eben nicht in der aktuellen Form. Allerdings sind die Querdenker in der Minderheit. Häufig sind es die etablierten, älteren Wissenschaftler, die Kritik üben. Vielleicht weil sie nicht mehr um ihre Karriere fürchten müssen.
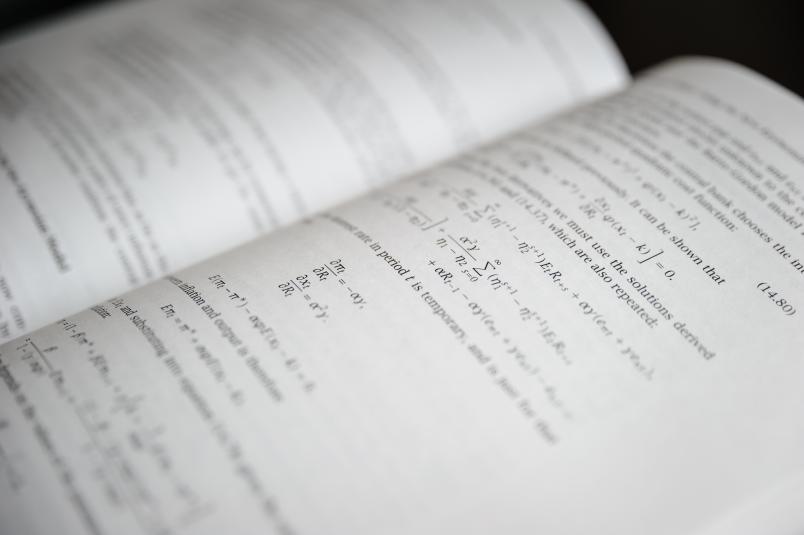
Haben Sie Hoffnung, dass sich das System eines Tages ändern könnte?
Politisch hat sich in den vergangenen Jahren etwas bewegt. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank erkennen seit Kurzem an, dass viele politische und ökonomische Probleme auf eine ungerechte Verteilung von finanziellen Mitteln zurückzuführen seien. Verteilungsfragen spart die Volkswirtschaftslehre derzeit weitestgehend aus. Das hat teilweise damit zu tun, dass sich solche Fragen mit den vorhandenen mathematischen Modellen nicht behandeln lassen. Vielleicht helfen solche Impulse von außen aber, dass mehr Ökonomen bereit sind, den Blick zu öffnen.
Gibt es denn auch etwas, das Sie aktiv tun können?
Wir starten gerade ein Forschungsprojekt mit Interviews und Umfragen unter den Nachwuchsforschern. Wir wollen herausfinden: Was prägt die Doktoranden? Wie kommen sie zu ihrem Thema? Haben sie Sorge, in der Karriere nicht voranzukommen, wenn sie bestimmte Methoden nicht verwenden? Wenn wir das Problem erst einmal dokumentiert haben, können wir über Lösungen nachdenken.





