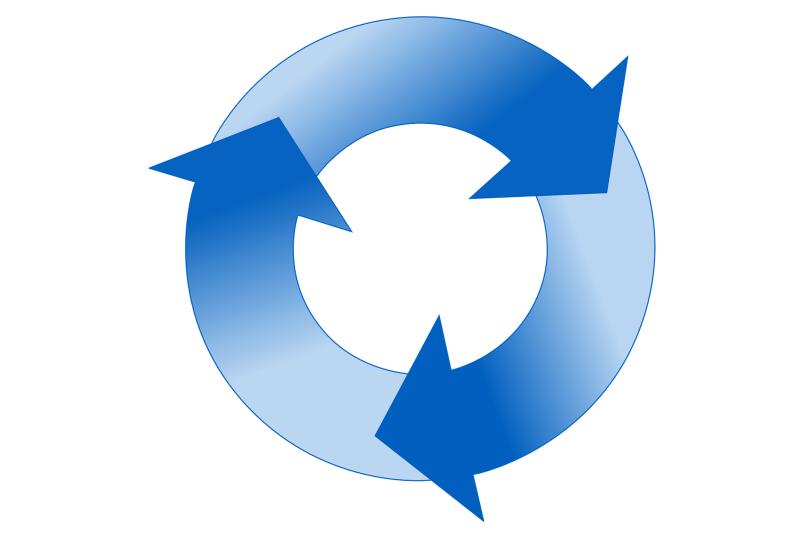Biochemie Mit diesem Trick produzieren Enzyme Wasserstoff
Die Natur stellt den potenziellen Energieträger mühelos und effizient her. Damit die Industrie das Produktionsprinzip abschauen kann, muss es zunächst verstanden sein.
Forscher aus Berlin und Bochum haben ein entscheidendes Detail im Reaktionsmechanismus von Wasserstoff produzierenden Enzymen aufgeklärt, wie sie etwa in Grünalgen vorkommen. Die Organismen kombinieren zwei Wasserstoffionen, auch Protonen genannt, mit zwei Elektronen und erzeugen so Wasserstoffgas. Das Besondere: Hat ein Enzym ein Elektron aufgenommen, sinkt eigentlich seine Neigung, noch ein zweites Elektron aufzunehmen. Wie es dennoch gelingt, beide Elektronen gemeinsam mit den Protonen zu Wasserstoff zu verknüpfen, zeigt eine Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“ erschienen ist.
Für die Arbeit kooperierten die RUB-Gruppen von Dr. Ulf-Peter Apfel aus der Fakultät für Chemie und Biochemie und Prof. Dr. Thomas Happe aus der Fakultät für Biologie und Biotechnologie mit Kollegen der Freien Universität Berlin um Dr. Sven Stripp.
Hilfreich für die künstliche Wasserstoffproduktion
Die Wissenschaftler zeigten, wie das Enzym beim schrittweisen Herstellen von Wasserstoff vorgeht: Immer dann, wenn es ein Elektron aufnimmt, bindet es auch ein Proton. Die positive Ladung des Protons kompensiert die negative Ladung des Elektrons, was einen stabilen Zwischenzustand des Enzyms entstehen lässt. So ist die Neigung, ein zweites Elektron aufzunehmen, etwa gleich wie beim ersten Elektron.

„Wenn wir die Mechanismen verstehen, mit denen diese Enzyme arbeiten, können wir daraus hilfreiche Schlüsse für das Design künstlicher Komplexe zur Produktion von Wasserstoffgas ableiten“, sagt Ulf-Peter Apfel.