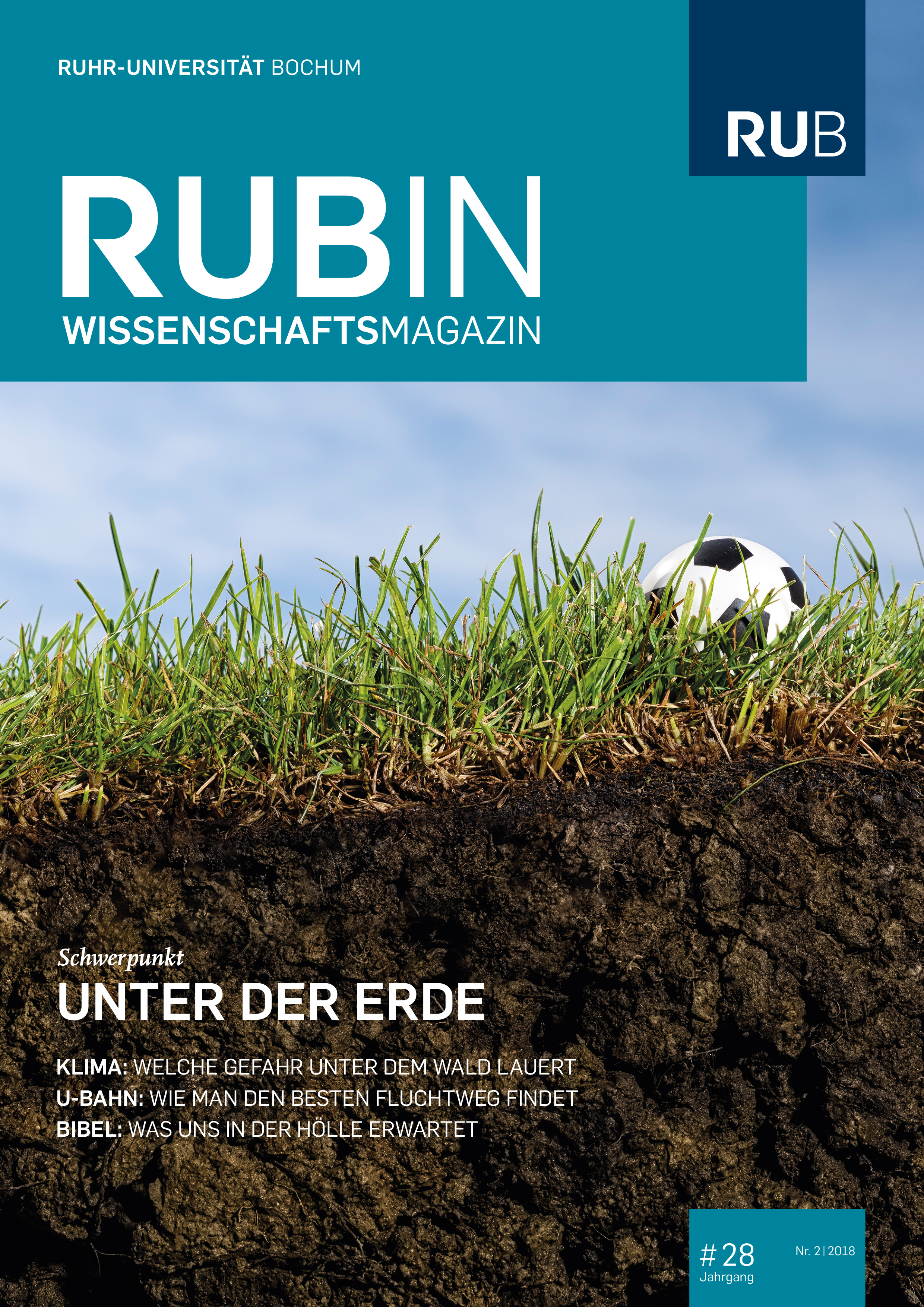Simulation
Den besten Fluchtweg aus U-Bahn-Stationen finden
Für dieses Projekt haben Forscher gleich dreimal einen Brand im Berliner U-Bahn-System gelegt.
Die U-Bahn ist aus deutschen Großstädten nicht mehr wegzudenken. Unmöglich wäre es, das gesamte Verkehrsaufkommen an der Oberfläche abzuwickeln. Allein die Berliner Verkehrsbetriebe zählten 2017 mehr als eine halbe Milliarde Fahrgäste in ihren U-Bahnen. Umso wichtiger ist es, die Menschen gegen Gefahren zu schützen – zum Beispiel gegen Brände oder Giftgasanschläge.
Wie das gelingen kann, damit hat sich das Team im Projekt Orpheus beschäftigt, kurz für Optimierung der Rauchableitung und Personenführung in U-Bahnhöfen: Experimente und Simulationen. „Unser Ziel ist es, Menschen im Katastrophenfall so schnell und sicher wie möglich aus den U-Bahnhöfen nach draußen leiten zu können“, erklärt Markus Brüne. Er arbeitet an der RUB in der Arbeitsgruppe Klimatologie extremer Standorte, die Prof. Dr. Andreas Pflitsch leitet.
Schneller als in Echtzeit
Im Orpheus-Projekt hat das Team die Grundlagen für ein System gelegt, das eines Tages schneller als in Echtzeit simulieren können soll, wie sich Rauch oder Gas in einer U-Bahn-Station ausbreitet, sodass der optimale Fluchtweg für einen spezifischen Fall ermittelt werden kann. Kompliziert ist das, weil jede Station ihre eigenen dynamischen Luftströmungen besitzt, die sich auch abhängig von äußeren Faktoren ändern können.

„Die deutschen U-Bahn-Systeme sind teils 100 Jahre alt, daher haben die meisten keine künstliche Belüftung“, erklärt Brüne. Die Luftzufuhr erfolgt durch die fahrenden Bahnen, die einen Luftschwall durch den Tunnel drücken. Darüber hinaus bildet sich im unterirdischen System der verzweigten Tunnel ein eigenes Klimasystem heraus, insbesondere eine natürliche Hintergrundströmung. Diese wird dominant, wenn der Zugverkehr im Katastrophenfall unterbrochen wird. Damit eine Computersimulation korrekt abbilden kann, wie sich Rauch in einer Station ausbreiten würde, muss die Luftströmung als Randbedingung berücksichtigt werden.
Feuer und Theaternebel in der U-Bahn-Station
Im Orpheus-Projekt statteten die Bochumer Forscher die Station „Osloer Straße“ in Berlin mit sogenannten Ultraschall-Anenometern aus. Diese Messgeräte erfassten bis zu acht Jahre lang ununterbrochen die Luftströmungen in dem Bahnhof; die Daten gingen in ein am Forschungszentrum Jülich entwickeltes Computermodell ein. Um zu überprüfen, wie gut die Simulation die Realität abbildet, fanden drei Großversuche in der Berliner Station statt. Das Projektteam löste dabei einen Propangasbrand aus und maß, wie sich der Rauch ausbreitete.
Zum einen brachten die Forscher dafür ein Tracergas aus, dessen Verteilung sie quantitativ erfassen konnten. Zum anderen versprühten sie Theaternebel, um einen optischen Eindruck zu bekommen, wie sich der Rauch ausbreiten würde. „Die Versuche waren sehr aufwendig“, sagt Markus Brüne, der vor Ort dabei war. „Und natürlich darf das Bauwerk nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.“
Versuche in der Nacht
Eine große Herausforderung war, dass das Experiment nur während der Betriebsruhe laufen durfte, aber jede Menge Messequipment aufgebaut werden musste. „Um 22 Uhr haben wir mit 30 bis 40 Leuten alles aufgebaut. Um 1.30 Uhr konnten wir in der Regel mit dem Versuch beginnen, weil dann keine Bahnen mehr fuhren“, erzählt der Forscher. „Um 3.20 Uhr musste dann das gesamte Equipment wieder raus sein.“
Vorherige Versuche hatten stets nur mit Kaltgas stattgefunden. Das gibt zwar Einblicke, wie sich Giftgas ausbreiten würde. Das Projektteam interessierte sich aber auch für brandbedingten Rauch. „Die Hitze eines Feuers treibt die Thermik an, das muss in der Simulation berücksichtigt werden“, erläutert Brüne. So beobachteten die Forscher zum Beispiel, dass sich im unteren Bereich der Station, wo sie den Brand ausgelöst hatten, deutliche Luftschichten bildeten. Der warme Rauch klebte an der Decke, die kalte Luft hing am Boden.

Es gibt Beispiele von Bränden in U-Bahn-Stationen, bei denen die meisten Menschen in den oberen Etagen ums Leben kamen.
Markus Brüne
In den oberen Etagen sah es hingegen anders aus. Schon nach wenigen Minuten gab es dort keine rauchfreie Schicht mehr, weil die Luft verwirbelte. Während man unten in der Station also noch gut atmen könnte, wäre es schwer bis unmöglich, über die Aufgänge aus dem Bahnhof herauszukommen, weil der Rauch dort den Weg versperren würde. „Es gibt Beispiele von Bränden in U-Bahn-Stationen, bei denen die meisten Menschen in den oberen Etagen ums Leben kamen, während unten relativ wenig passiert ist“, weiß Brüne.
Basierend auf den Ergebnissen schlägt das Projektteam daher vor, die meist rauchfrei bleibenden U-Bahn-Tunnel als Fluchtwege in Betracht zu ziehen. „Das wollen die Betreiber bislang nur ungern, weil sie Sorge haben, dass es Zusammenstöße zwischen den Menschen und eventuell noch fahrenden Zügen geben könnte“, erklärt Markus Brüne. „Aber unsere Ergebnisse zeigen, dass es sinnvoll wäre.“ Eine Simulation, die den Einsatzkräften im Ernstfall sagen würde, wohin sich der Rauch wahrscheinlich ausbreiten wird, wäre hilfreich, um den bestmöglichen Fluchtweg zu ermitteln.
Luftströmung mit Kommunikationskabeln messen
Damit das im Projekt entstandene Modell für verschiedene U-Bahn-Stationen zuverlässige Prognosen liefert, müsste jedoch für jeden Bahnhof die natürliche Luftströmung bekannt sein. Unmöglich wäre es, sie wie im Versuch mit Hunderten von Ultraschall-Anenometern zu messen – zu aufwendig und zu kostspielig. Markus Brüne verfolgt während seiner Promotion an der Ruhr-Universität daher einen anderen Ansatz. Er überprüft, ob sich die Luftströmung aus Temperaturmessungen ableiten lässt. Die Temperatur lässt sich wie in einem Brandmelder über Lichtwellenleiter erfassen – und die sind bereits zahlreich in U-Bahn-Tunneln verbaut.
„Die Kommunikationskabel in U-Bahn-Systemen bestehen aus Lichtwellenleitern“, beschreibt Markus Brüne die Idee. „Wir untersuchen, ob man die Temperatur mit diesen bereits vorhandenen Lichtwellenleitern messen könnte.“ Zur Kontrolle erfassen die Forscher die Temperatur im gleichen U-Bahn-Tunnel außerdem mit einem speziell für den Versuch angebrachten Lichtwellenleiter sowie mit herkömmlichen Temperatursensoren. Die Ergebnisse sind laut Markus Brüne vielversprechend. „Das Kommunikationskabel ist zwar träge“, berichtet er. „Man hat im Vergleich zu den anderen Messmethoden damit einen Zeitversatz von fünf bis zehn Minuten.“ Aber es übermittelt langsame Temperaturveränderungen korrekt und sollte für eine normale Strömungsmessung reichen, so seine Einschätzung.
Ob sich die Luftströmung zuverlässig aus den Temperaturdaten rekonstruieren lässt, muss Brüne noch überprüfen. Falls ja, wäre wieder ein wichtiger Schritt in Richtung einer Echtzeit-Brandsimulation gelungen.