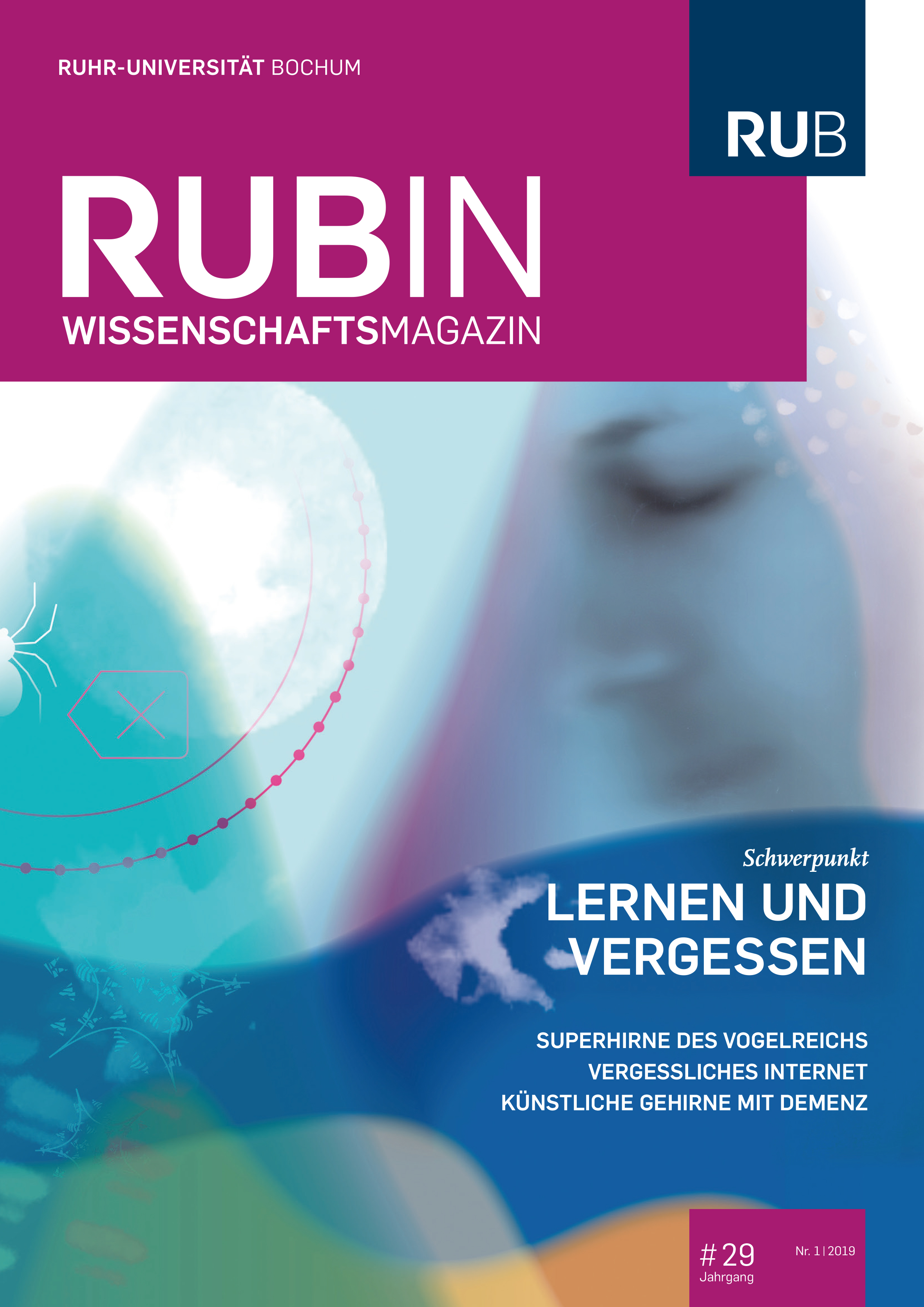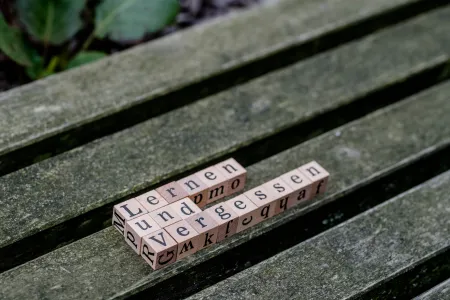Sportwissenschaft
Mit dem Körper lernen
Sport im klassischen Sinne lernen die Studierenden in den Kursen von Antje Klinge nicht. Dafür aber viel über sich selbst.
Antje Klinge bezeichnet sich selbst als Grenzgängerin innerhalb ihrer Fakultät. Die Professorin leitet an der RUB den Lehr- und Forschungsbereich Sportpädagogik und Sportdidaktik und hat ein etwas anderes Verständnis von Sport als die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen. „In Bochum ist die Sportfakultät eher klassisch ausgerichtet. Viele denken bei Sport an körperliche Hochleistung, fitte Körper und vor allem Wettkämpfe“, sagt sie. Das gehöre natürlich auch dazu, für sie ist es aber noch mehr. „Ich fasse den Begriff Sport viel weiter, spreche lieber von Bewegung, noch lieber von spielerischem Bewegungshandeln.“ Im Sinn hat sie dabei nicht Spiele mit vorgegebenen Techniken, sondern ein Bewegen ohne festgelegte Grenzen und Regeln, wie man es vor allem bei Kindern beobachten kann und für das man nie zu alt sei.

Jeder Mensch ist ein Tänzer.
Rudolf von Laban
Leistungssportlerin war Antje Klinge nie, der kreative Tanz ist ihre Profession. Er wird von der Kunst beeinflusst und begreift den Körper als sinnliches Organ, mit dem Menschen Empfindungen aufnehmen und ihr Inneres ausdrücken können. Nicht bestimmte Tanzstile stehen hierbei im Vordergrund, sondern Improvisation und das Entdecken der eigenen Bewegungs- und Spielräume. Vor allem die Studierenden, die lange Jahre Wettkampfsport betrieben haben, äußern oft Vorbehalte gegen solche Übungen. Aus Angst, sich ungeschickt anzustellen, sich schlimmstenfalls lächerlich zu machen. „Die meisten merken aber schnell, dass diese Sorgen unbegründet sind. Einige blühen regelrecht auf. Denn wie schon der Tanztheoretiker Rudolf von Laban sagte: ‚Jeder Mensch ist ein Tänzer‘“, erklärt die Wissenschaftlerin.

Ihre Beobachtungen in den Kursen wie auch im Schulsport zeigten ihr, dass das Tanzen etwas mit den Menschen macht: „Da passiert etwas mit ihrer Identität. Sie stellen sich anders dar als im herkömmlichen Sport, individueller“, so Klinge. Über diesen Zusammenhang zwischen spielerischer Bewegung und Identitätsentwicklung wollte Antje Klinge mehr herausfinden. Antworten auf ihre Fragen fand sie in leibphänomenologischen, körpersoziologischen und Bildungstheorien.
Der Bildungswissenschaftler Jürgen Baumert unterscheidet vier Zugänge des Menschen zur Welt: den kognitiv/rationalen, den religiös/philosophischen, den normativ/evaluativen und den ästhetisch/expressiven, zu dem die physische Expression, das Erfahren der Welt über den Körper gehört. Keiner dieser Zugänge sei ersetzbar durch einen anderen. Lernen erschöpfe sich demnach nicht in der Ansammlung rationalen Wissens, um an der Gesellschaft kompetent teilhaben zu können, sondern umfasse auch leibliche Erfahrungen und Erkenntnisse. Nur so könne der Mensch die Welt in ihrer Vielperspektivität mit allen Sinnen wahrnehmen.

„Mir wurde bewusst, welche Rolle der Körper als Instrument der Bildung hat. Wenn wir über ihn neue Erfahrungen machen, stutzen wir vielleicht zunächst und akzeptieren dann, dass wir umlernen und neue Perspektiven einnehmen müssen“, sagt Antje Klinge. Ihren Studierenden versucht sie das ganz plastisch klarzumachen.
Warum immer nur im Kreis laufen?
Das fängt schon damit an, sich in der Sporthalle anders zu bewegen, als man es üblicherweise tut. „Wenn ich die Studierenden zu Beginn einer Stunde auffordere, sich warm zu machen, laufen nahezu alle automatisch links herum im Kreis. Dann mache ich ihnen klar, dass das nicht sein muss. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Man kann genauso gut rechtsherum oder rückwärtslaufen, im Zickzack hüpfen oder die Halle ohne jegliches Muster durchqueren“, so Klinge, die sich sicher ist, dass schon mit dieser simplen Übung Bildungsprozesse angestoßen werden.
Eine Steigerung finden solche Aufgabenstellungen außerhalb der Halle, mitten auf dem Campus oder in der Stadt, wenn sich die Kursteilnehmer des Seminars „Kulturelle Bildung“ ihre Umwelt aus neuen, ungewohnten Perspektiven mit dem Körper erschließen. Das kann dann so aussehen, dass sich Männer und Frauen um Betonblöcke winden, ihre Köpfe in Regalfächer stecken oder sich in die Schließfächer der Bibliothek hineinsetzen .
Ungewohntes bringt Denkprozesse in Gang
Auch der Raum selbst kann solch ein Umlernen in Gang setzen. Wahrscheinlich hat jeder zum Beispiel schon einmal die Erfahrung gemacht, dass man völlig aus dem Tritt kommt, wenn man eine Treppe besteigt, deren Stufenhöhe eine ganz andere ist als die gewohnte. Der Effekt bei solchen Wahrnehmungsübungen ist immer der: „Man lernt nicht nur etwas über Bewegung, sondern auch etwas über sich und die Welt“, fasst Antje Klinge zusammen.

Diese Vielperspektivität in die Köpfe und Körper ihrer Studierenden zu bringen, ist Antje Klinge vor allem im Hinblick auf das Berufsfeld Schule sehr wichtig, denn die Sportlehrerinnen und -lehrer in spe sollen keineswegs als Trainer fungieren, sondern als Lehrende und Vermittler von Bewegung, Spiel und Sport. „Sportlehrkräfte haben einen Doppelauftrag“, erklärt die Professorin. „Sie sollen einerseits Kindern die Möglichkeit eröffnen, sich die außerschulische Bewegungskultur selbstständig zu erschließen, sprich beim Sport mitspielen zu können, und andererseits sollen die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu entfalten und ihre Bewegungsmöglichkeiten kennenzulernen.“

Der Sport ist nicht in Stein gemeißelt, seine Regeln sind immer auch veränderbar.
Antje Klinge
Das ginge über kreativen Tanz ganz hervorragend, doch auch alle anderen Bewegungsformen und Sportarten könnten dafür eingesetzt werden. „Der Sport ist nicht in Stein gemeißelt, seine Regeln sind immer auch veränderbar“, ist Klinge überzeugt. So könnte Fußball mal mit vier Toren und drei Bällen gespielt werden, ein Foul in Zeitlupe nachgestellt und damit sichtbarer werden oder ein sehender Schüler einen, dem die Augen verbunden sind, über einen Hindernisparcours führen, ohne zu sprechen. „Solche und ähnliche Aufgabenstellungen stellen das Selbstverständliche infrage und regen dazu an, neue, andere Perspektiven einzunehmen und zu überdenken“, so Klinge.

Doch häufig fordern Schüler von ihren Lehrerinnen und Lehrern den ganz klassischen Sport ein, diese Erfahrung hat Antje Klinge in ihrer Zeit als Lehrerin selbst gemacht. Viele Lehrkräfte gäben dem auch nach – sei es, weil sie sich selbst als Sportler sehen und den Wunsch, sich mit anderen zu messen, kennen, oder weil die Benotung der Leistungen ihnen so einfacher erscheint. Mit ihren Kursen und Seminaren will Antje Klinge diesem Phänomen entgegenwirken und setzt auf die Potenziale des Lernens mit dem Körper.