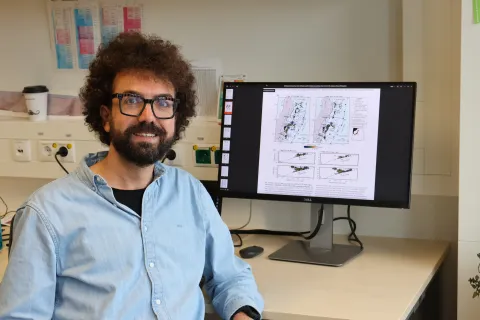Rettung von Forschungsdaten
Allein in den alten Kupferminen von Alaska
Corona hat viele Forschungsprojekte jäh gestoppt. Klimatologe Andreas Pflitsch hatte Glück: Er durfte in die USA reisen, um seine Forschungsdaten zu retten. Mehrere Jahre Arbeit wären sonst verloren gewesen.
Prof. Dr. Andreas Pflitsch hat schon einige Reisen auf dem Buckel. Trips auf Gletscher und Vulkane sind für den RUB-Klimatologen keine Seltenheit. Normalerweise bereitet ein internationales Team diese Touren von langer Hand vor. 2020 kam alles anders. „Unsere geplanten Expeditionen im Frühjahr mussten aufgrund von Corona alle abgesagt werden“, erzählt Pflitsch. Stattdessen verbrachte er Ende September/Anfang Oktober eine Woche allein in der Wildnis von Alaska, um sein Forschungsequipment in den Kupferminen von Kennicott zu retten. Auch Eis- und Gletscherhöhlen in Oregon und South Dakota steuerte er an.
„Hätte diese Reise nicht geklappt, wären die Daten von mehreren Jahren Forschungsarbeit verloren gewesen“, sagt der Wissenschaftler. „Ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass die Verwaltung der RUB mir unter Auflagen eine Reisegenehmigung erteilt hat.“ Mit dem Segen der Ruhr-Uni und einer Sondergenehmigung der US-Regierung durfte Pflitsch in die Vereinigten Staaten fliegen.

Ich wollte schon immer in diesen Minen forschen.
Andreas Pflitsch
Eines seiner Ziele war der Wrangell-St.-Elias-Nationalpark in Alaska, wo er die Klimadynamik der alten Kupferminen von Kennicott untersucht. „Ich wollte schon immer in diesen Minen forschen“, erinnert er sich. „Zehn Jahre lang habe ich versucht, eine Genehmigung vom Nationalpark zu bekommen. Aber es hieß lange, dass das zu gefährlich sei.“
Privateigentümer verschafft Zutritt zur Mine
Der Zufall wollte es, dass er schließlich trotzdem Zutritt bekam. Denn ein Teil des alten Minengeländes ist mittlerweile in privater Hand und soll für den Tourismus zugänglich gemacht werden. Das Problem: Die Mine ist von innen zugefroren und taut nur langsam wieder auf. Als der Besitzer einen Vortrag von Andreas Pflitsch hörte, interessierte er sich sehr für dessen Arbeit. „Wenn man die Klimatologie der Mine versteht, weiß man auch, welche Eingänge man am besten öffnen oder schließen muss, um die Luftzirkulation so zu beeinflussen, dass ein bestimmter Bereich schneller auftaut“, erklärt Andreas Pflitsch. So verschuf der private Besitzer ihm Zugang zu seinem Teil der Mine, um genau diese Dinge herauszufinden. Als die Arbeit erst einmal angelaufen war, kamen plötzlich auch die Verantwortlichen des Nationalparks wieder auf den Bochumer Wissenschaftler zu und wollten, dass er für sie ebenfalls Experimente durchführt.

So brachte Pflitsch in zwei Bereichen des Minensystems zum Beispiel Messgeräte für Temperatur, Luftfeuchte und Luftströmungen aus. Viele Sensoren hängen an einem mehrere hundert Meter langen Kevlar-Seil, das durch einen senkrechten Schacht von einem Teil der Mine in einen tiefergelegenen reicht. „Das Seil ist zwar stabil, aber wenn es zu sehr vereist, reißt es“, sagt Pflitsch. „Einmal im Jahr muss ich hinfahren und die mehrere Zentimeter dicke Eisschicht vom Seil von Hand abschlagen. Das dauert.“
Ursprünglich war die Alaska-Reise als Exkursion mit Studierenden geplant gewesen, aufgrund der Coronasituation musste Andreas Pflitsch jedoch auf weitere helfende Hände verzichten.
Sechs Tage brachte Andreas Pflitsch allein in der Wildnis von Alaska zu, ohne Strom und fließendes Wasser. Sechs Tage, um ein Seil vom Eis zu befreien? „Ich habe auch noch neue Messausrüstung installiert und die Daten aus den Sensoren ausgelesen – das war ein voller Erfolg. Jetzt weiß ich, wie die Luft im Sommer und im Winter in der Mine strömt, und wie man den Auftauprozess beschleunigen könnte.“

Wenn ich mit dem Auto zur Uni fahre, ist das auch nicht ohne Risiko.
Andreas Pflitsch
Auf die Frage, ob der Anfang Sechzigjährige eigentlich niemals Angst auf seiner Reise gehabt habe, antwortet er ohne Zögern: „Nein, ich habe mich auf der ganzen Tour sicher gefühlt. Ich kenne das Gebiet gut und bin erfahren, habe sogar vor der Reise noch eine besondere Kranken- und Bergungsversicherung abgeschlossen. Ich habe also alles getan, was ich tun konnte, der Rest ist höhere Gewalt. Natürlich kann immer etwas passieren. Aber wenn ich mit dem Auto zur Uni fahre, ist das auch nicht ohne Risiko.“

Andreas Pflitsch nutzte die Reise aber nicht nur für die Arbeit in den Minen. Er war insgesamt vier Wochen in den USA unterwegs, um mehrere Forschungsstandorte abzuklappern. In South Dakota setzte er ein neues Experiment für eine Doktorandin auf, die derzeit nicht ins Ausland reisen darf, und sammelte Messdaten für sie. Außerdem war er zu Beginn des Trips in Oregon. Aus praktischen Gründen: „Keiner hatte mir vor der Reise in die USA sagen können, ob ich 14 Tage in Quarantäne gehen muss oder nicht“, erinnert sich Pflitsch. „Daher bin ich zunächst nach Oregon geflogen, wo ich privat hätte unterkommen können. Denn zwei Wochen allein in einem Hotel in Alaska in Quarantäne zu sitzen, ohne dass einen jemand versorgen kann – das will wirklich niemand!“
Messequipment in Eishöhlen nicht leicht wiederzufinden
In Quarantäne musste er dann nicht. Aber da er eh schon dort war, nutzte er die Gelegenheit für eine Tagestour auf den Mount St. Helens, einen eisbedeckten aktiven Vulkan, in dessen Krater er seit mehreren Jahren die Eishöhlen erforscht. „Die Höhlen verändern sich so schnell, dass man einmal im Jahr das Messequipment bergen muss“, weiß Pflitsch. „Wenn du zwei Jahre nicht dort bist, kann es sein, dass du nichts mehr wiederfindest.“ In der Tat stellte das Team auf dem Mount St. Helens fest, dass mehrere hundert Meter der Mothra Cave, die sie 2019 besucht hatten, nicht mehr existierten.





Auch der Trip auf den Mount St. Helens lohnte sich für Andreas Pflitsch. Aus zahlreichen Sensoren konnte er Daten auslesen. Das klappt nicht immer so gut. „Manchmal geht auf den Reisen so viel schief, dass man gar nichts auf die Reihe bekommt“, gibt er zu. „Dieses Mal war alles perfekt, ich habe so viele neue Erkenntnisse gewonnen.“ Zum Beispiel über die Fumarolen, Erdspalten, die vulkanische Gase ausströmen. Wie Pflitsch nun herausfand, gehen sie im Dezember in eine Art Winterschlaf: Das ganze System stellt seine Aktivität ein und fährt erst im Januar wieder hoch – ein verblüffendes Ergebnis für den Forscher.
„Die Tour war anstrengend, vor allem das Reisen unter Corona-Bedingungen“, resümiert Pflitsch. „Aber ich bin wirklich froh, wie es gelaufen ist – vor allem, wenn ich mich daran erinnere, wie schlecht ich drauf war, als ich im Frühjahr dachte, ich könnte dieses Jahr überhaupt nichts machen.“