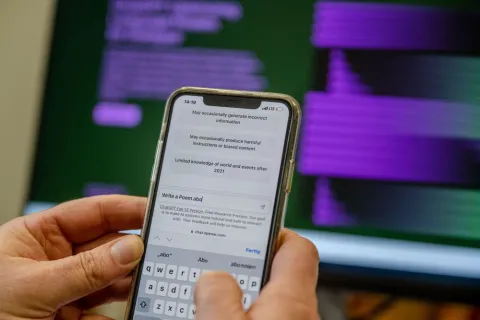Astronomie
Bahnbrechende Entdeckung am Radiohimmel
Woher stammen periodische Radioausbrüche im All? Beobachtungen zweier gekoppelter Teleskope haben bisherige Vermutungen über den Haufen geworfen.
Durch die Kombination der Daten zweier Radioteleskope hat ein internationales Team der Astronomie unter Beteiligung des RUB-Astronomen Dr. Björn Adebahr (Lehstuhl Astronomie, Prof. Dr. Ralf-Jürgen Dettmar) neue Erkenntnisse über sogenannte Fast Radio Bursts gewonnen. Anders als bisher angenommen, können diese energiereichen Ausbrüche nicht durch sich umkreisende Doppelsterne entstehen. Vielmehr vermutet das Team, dass magnetisierte, isolierte Neutronensterne die Quelle sein könnten. Es berichtet in Nature vom 25. August 2021.
Zwei Wellenlängen zeitgleich beobachten
Die Forschenden haben die beiden Radioteleskope LOFAR – Low Frequency Array – und das Westerbork-Teleskop miteinander verbunden. Letzteres misst Radiowellen mit einer Wellenlänge von 21 Zentimetern, LOFAR empfängt Wellenlängen von etwa drei Metern. Beide Teleskope werden von ASTRON, dem niederländischen Institut für Radioastronomie, betrieben. Ein maschinelles Echtzeitlernsystem ermöglichte erstmals die gleichzeitige Beobachtung beider Wellenlängen.
Im Fokus des Interesses stand der Fast Radio Burst FRB 20180916B. Fast Radio Bursts gehören zu den hellsten Blitzen am Radiohimmel. Sie dauern nur etwa ein Tausendstel einer Sekunde. Die Energie, die für die Entstehung von Fast Radio Bursts erforderlich ist, muss außerordentlich hoch sein. Dennoch ist ihre genaue Natur unbekannt. Einige Fast Radio Bursts wiederholen sich, und im Fall von FRB 20180916B ist diese Wiederholung periodisch. Diese Periodizität führte zu einer Reihe von Modellen, nach denen die Fast Radio Bursts von einem Paar von Sternen ausgehen, die sich gegenseitig umkreisen. Die binäre Umlaufbahn und der stellare Wind erzeugen dann die Periodizität.
Überraschung für das Forschungsteam
Die Analyse der Daten aus der Doppelbeobachtung überraschte das Forschungsteam. Binärwindmodelle sagten voraus, dass die Ausbrüche nur im kurzwelligen Radiobereich leuchten oder zumindest viel länger dauern sollten. Zu sehen waren aber zwei Tage lang kurzwellige Radioausbrüche, gefolgt von drei Tagen mit langwelligen Radioausbrüchen. Somit schlossen die Forschenden das ursprüngliche Modell aus.
Stattdessen vermuten sie sogenannte Magnetare als Quelle der Fast Radio Brusts. Es handelt sich dabei um Neutronensterne, die eine viel höhere Dichte als Blei haben und zudem stark magnetisch sind. Ihre Magnetfelder sind um ein Vielfaches stärker als der stärkste Magnet in jedem irdischen Labor. Ein isolierter, langsam rotierender Magnetar erkläre das entdeckte Verhalten am besten, so das Forschungsteam.