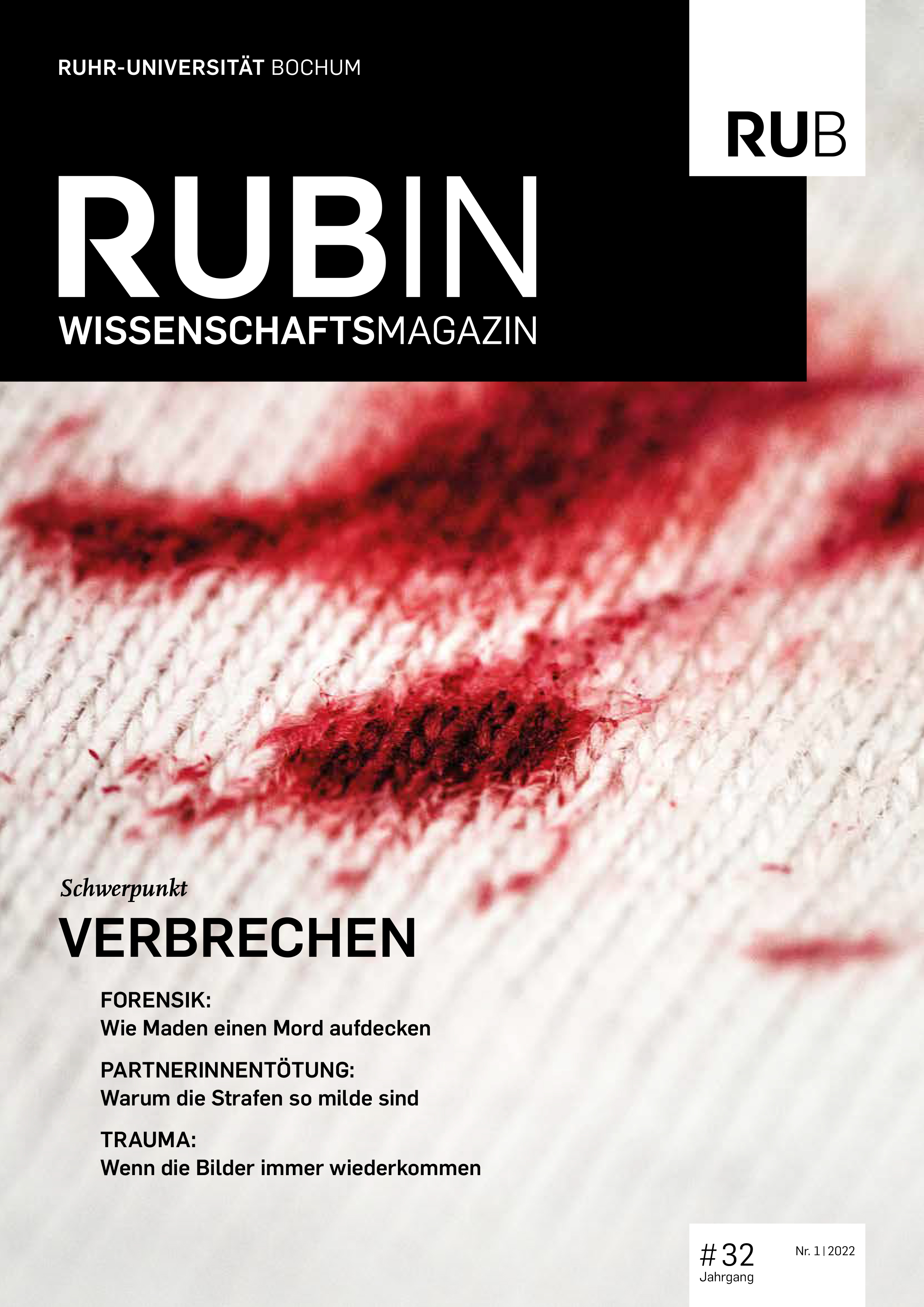Medienwissenschaft
Zeugenbericht eines Kühlschranks
Digitale Datenspuren verraten professionellen Forensikerinnen und Forensikern einiges. Aber nicht nur ihnen.
Smarte Zahnbürsten, Glühbirnen und Fitnessuhren, vernetzte Garagentore und Haustüren mit Videoerkennungssystemen, personalisierte Social-Media-Profile und Streaming-Accounts – überall hinterlassen wir im heutigen Alltag digitale Spuren. Das gilt auch für Täterinnen und Täter – und freut professionelle Forensikerinnen und Forensiker, die mittlerweile über einen Fuhrpark an hochtechnologisierten Instrumenten und Computerverfahren verfügen, um an diesen neuen Medientatorten zu ermitteln. So können sie ganze Tatorte dreidimensional einscannen und virtuell begehbar machen, Sensoren von smarten Kühlschränken und Lichtsystemen auslesen und damit Tathergänge exakt rekonstruieren. In seinem Buch „Medien der Forensik“ gibt Prof. Dr. Simon Rothöhler Einblicke in derartige Verfahren. Darüber hinaus nimmt der Medienwissenschaftler auch populäre forensische Praktiken unter die Lupe. „Serien-Franchises wie CSI oder zuletzt vor allem True-Crime-Formate, die oftmals Forensik-Anteile enthalten, sind gerade auf Streaming-Plattformen sehr beliebt. Zivilgesellschaftliche Investigativagenturen wie Bellingcat oder Forensic Architecture arbeiten ebenfalls forensisch – an der Schnittstelle zwischen Kunst und Aktivismus. Forensik begegnet uns überall im Alltag“, so Rothöhler.
[infobox: 1]
Institutionelle Forensik
Doch zunächst zur institutionellen forensischen Praxis: Was tun professionelle Forensikerinnen und Forensiker, und was verstehen sie unter Medien? „Forensikerinnen und Forensiker sind zunächst staatliche und staatsnahe Akteure, die von Kriminaldienststellen und Staatsanwaltschaften aufgefordert werden, sich an der Aufklärung und Analyse krimineller Handlungen zu beteiligen“, erklärt Rothöhler, der sich für einen medien- und wissensgeschichtlichen Zugang zur Forensik interessiert. Bei der forensischen Ermittlungsarbeit spielen Medien an verschiedenen Stellen eine Rolle: von dem Moment an, an dem die Profis einen Tatort betreten und das sogenannte Spurenbild fotografisch oder lasermesstechnisch dokumentieren, über die Untersuchung der Proben in den Laboren, wenn digitale Vergleichsbibliotheken über Computernetzwerke abgerufen werden, bis zu den Auftritten forensischer Sachverständiger vor Gericht, wo die Befunde auch für Laien verständlich aufbereitet, dargestellt und kommuniziert werden müssen.
[einzelbild: 3]
„Forensik ist als institutionelle Praxis um die Untersuchung von Spuren gebaut. Die Spur steht also im Zentrum“, so der Medienwissenschaftler. Dabei kann die Spur in gewisser Weise selbst schon als Mediator verstanden werden, denn sie ist nicht die Sache selbst, sondern etwas Vermittelndes, ein Handlungsrest, etwas, das übriggeblieben ist und rückwärts ausgelesen werden muss. „Es gibt also einerseits Spuren, die so gesehen Medien sind und als Reste eine Verbindung zu vergangenen Zeiträumen herstellen, und andererseits technische forensische Medien, die sich besonders gut dazu eignen, Spuren auszulesen“, fasst Rothöhler zusammen.
[einzelbild: 1]
Digitale Spuren
Blut, Haare, Speichelreste, Reifenabdrücke – es gibt eine Vielzahl materieller Spuren und damit auch viele Sachverständigengebiete. „In dieser Liste taucht Medientechnik als explizites Sachverständigengebiet erst recht spät auf“, weiß Rothöhler. Mit der Digitalisierung änderte sich das. „Die digitale Dimension von Tatorten wird heute von der institutionellen Forensik intensiv in den Blick genommen“, erzählt der Medienwissenschaftler. Denn mit der Digitalisierung des Alltags kommt es zu einem enormen Aufkommen an digitalen Spuren und Daten. Fast jede Handlung, jede Kommunikation, jedes Telefonat, jede Interaktion ist heute mit einer informationstechnischen Spur verbunden. „Es ist relativ schwierig, sich durch die Gegenwart zu bewegen und nicht ständig sensorisch erfasst zu werden oder sonstige digitale Spuren zu hinterlassen. Tracking und Tracing sind überall“, so Rothöhler.
[einzelbild: 2]
Neue Zeugen
Damit bezieht sich der Medienwissenschaftler vor allem auf Geräte jenseits der klassischen Überwachungssysteme, wie beispielsweise Smartphones oder auch intelligente Kühlschränke, Lautsprecher oder Heizsysteme. All diese Alltagsgeräte haben Netzwerkzugang und speichern Daten, die wiederum forensisch ausgelesen werden können. „Der Begriff Medienforensik umfasst nicht nur Medien im engeren Sinne, wie etwa Tonaufnahmen und Bilder, sondern alles, was um den vernetzten Computer herum gebaut ist und als Internet der Dinge bezeichnet wird“, erklärt Rothöhler. Und tatsächlich hat es Fälle gegeben, in denen Forensikerinnen und Forensiker einen Mörder mithilfe der Sensoren eines smarten Kühlschranks erfassen und schlussendlich überführen konnten. „Digitale Medien sind sehr viel weniger flüchtig als gemeinhin angenommen. Das Digitale ist auch kein Reich des Immateriellen. Daten sind immer irgendwo physisch gespeichert. Für Festplatten und auch andere Speicherformen gilt: Vermeintlich Gelöschtes ist oft leicht rekonstruierbar.“ Diese Eigenschaft macht sich vor allem die Computerforensik als zunehmend wichtiges Teilgebiet der professionellen Medienforensik zunutze.
Medienforensische Ermittlungen neu gedacht
Unweigerlich hat die Digitalisierung nicht nur das Spuraufkommen erhöht; sie hat auch die forensische Informationsgewinnung der Ermittlungsbehörden verändert, für neue Einsatzgebiete und komplexere Formen der Spurensicherung gesorgt. Um zu überprüfen, ob digitales Bild-, Audio- oder Video-Material echt ist, müssen Medienforensikerinnen und Medienforensiker heute tief in den Metadaten und Pixelstrukturen Ausschau nach Störungen, Manipulationen und verdächtigen Mustern halten. Weist irgendetwas darauf hin, dass mit den Bildern gearbeitet wurde, sie gefälscht worden sind? „Medienforensische Authentifizierung bedeutet in der Regel lediglich, dass keine Eingriffspuren nachweisbar sind“, so Rothöhler.
Virtuell begehbare Tatorte
Um die komplexen Daten und die digitalen Transportwege nachzuverfolgen und zu entschlüsseln, sind Forensikerinnen und Forensiker immer mehr auf computergestützte Hilfsmittel und hochspezifische Software angewiesen. „In der professionellen Forensik findet hochinteressante angewandte Medienforschung statt. Oftmals kommen avancierteste Techniken zum Einsatz“, weiß Rothöhler. Das gilt zum Beispiel für den Bereich der Tatortfotografie. „Mithilfe von 3D-Laserscannern messen Forensikerinnen und Forensiker heute Räume aus und frieren so den Tatort bildmesstechnisch ein. Am Ende ist der Tatort virtuell modelliert und begehbar“, berichtet Rothöhler. Einige Landeskriminalämter hätten ganze Holo-Decks zur Verfügung, um Tatorte digital nachzubauen, die Avatare von Tätern, Opfern und Zeugen zu bewegen und so Aussagen überprüfen zu können. Was konnte die Zeugin, der Zeuge tatsächlich sehen? Wie weit war die Hand von der Tatwaffe entfernt? Auf diese Weise konnten schon Falschaussagen enttarnt werden.
Physische Grenzen
Die digitalen Medien stellen die institutionelle Forensik auch vor einige Herausforderungen, zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wo sich Daten, die in der „Cloud“ gespeichert wurden, physisch befinden oder wie man an Daten gelangt, die auf Servern außerhalb Europas liegen. „Die ganze Spurensuche gestaltet sich unter digitalen Bedingungen komplizierter, weil der Tatort, medientechnisch gesehen, tendenziell global ist. Digitale Daten sind komplex verteilt – und häufig Privateigentum großer Plattformbetreiber“, beschreibt Rothöhler die Herausforderung der forensischen Spurensuche.
Popularisierung der Forensik
In seinem Buch spricht Rothöhler auch von einer Popularisierung der Forensik. „Es gibt eindeutig eine Faszinationsgeschichte der Forensik“, erklärt der Medienwissenschaftler. Wirft man einen Blick in die Literatur, in Filme, Serien oder Podcasts, begegne man immer wieder sich ähnelnden Darstellungen forensischer Praktiken. „Forensikerinnen und Forensiker sind, wie bei CSI, häufig die eigentlichen Stars. In weißen Kitteln stehen sie in Laboren, examinieren kleinste Spurpartikel unter dem Mikroskop und finden den entscheidenden, unwiderlegbaren Beweis.“ Dabei ist Medienforensik mittlerweile auch in dem Sinne popularisiert, als sie in abgewandelter Form Teil unseres Alltags geworden ist, argumentiert Rothöhler.
Paraforensisches Verhalten
„Schreibt uns eine unbekannte Person eine E-Mail, recherchieren wir fast automatisch den Namen, stoßen in der Suchergebnisliste auf einen Social-Media-Account und studieren dann, was ihm oder ihr so gefällt, was geliked, geteilt, kommentiert wird und so weiter. Wir lesen also ständig und alltäglich digitale Spuren aus – wie Forensikerinnen und Forensiker.“ Das sei auch der Fall, wenn wir in Freundschaftsnetzwerken unterwegs sind, Restaurants oder Urlaubsziele auswählen. All diese gewöhnlichen Praktiken könne man als Paraforensik oder Pseudoforensik bezeichnen. Wir ahmen echte Forensikerinnen und Forensiker nach. „Das ist unsere Reaktion auf die Komplexität der digitalen Medien. Wir sind uns bewusst, dass sie überall sind, uns beobachten, registrieren, uns kalkulierend Serien und Konsumgüter vorschlagen. Man könnte pseudoforensisches Verhalten auch als Abwehrreaktion gegen die omnipräsente Verdatung begreifen – oder als Aneignungsversuch“, so Rothöhler. Und natürlich gebe es auch hier pathologische Formen – wie etwa bei medienskeptischen Verschwörungsdenkenden.
[infobox: 2]