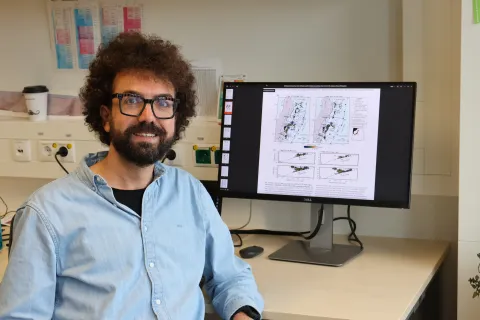ERC Starting Grant
Geologische Bewegungen mit GPS beobachten
Globale Satellitennavigationssysteme erlauben, Erdbewegungen präzise zu verfolgen. Im Rahmen eines ERC Grants, den Jonathan Bedford mit an die RUB bringt, soll dieses Potenzial weiter erschlossen werden.
In Südeuropa ist die Erdbebengefahr allgegenwärtig. Mehrere kleine tektonische Platten, sogenannte Mikroplatten, scheinen sich dort simultan zu bewegen. Die räumlich-zeitliche Komplexität dieser Bewegungen ist bislang kaum verstanden. Mit ihr beschäftigt sich Prof. Dr. Jonathan Bedford vom RUB-Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik im Rahmen eines ERC Starting Grants. Er hat seit 1. Juni 2022 die Professur für Physikalische Geodäsie inne. Sein Starting Grant ist mit 1,85 Millionen Euro dotiert. Der Forscher plant unter anderem, ein preisgünstiges Satellitennavigationssystem in Griechenland aufzubauen – welches das erste seiner Art weltweit sein wird.
Systeme speziell für die Geowissenschaft
Globale Satellitennavigationssysteme – umgangssprachlich als GPS bezeichnet – können nicht nur Autofahrerinnen und Fußgängern bei der Navigation helfen. Sie können auch die Bewegung von vielen anderen Dingen messen – zum Beispiel von den tektonischen Platten der Erde. Weltweit gibt es mehr als 20.000 Messstationen globaler Satellitennavigationssysteme (GNSS für global navigation satellite system), die speziell für die geowissenschaftliche Forschung implementiert wurden. Sie funktionieren millimetergenau.
Satellitennavigationssysteme und GPS
Mit einer solchen Technik lassen sich zum Beispiel geologische Bewegungen im Bereich von Verwerfungen, also Brüchen in der Erdkruste beobachten. Dort können Erdbeben entstehen, wenn sich eine Spannung entlang der Verwerfung bildet und in einer ruckartigen Bewegung entlädt. Die Bewegungen im Umfeld der Verwerfung können mittels GNSS registriert werden, und zwar selbst dann, wenn sie im Verborgenen erfolgen, also ohne ein Erdbeben auszulösen.
Die Technik weiterentwickeln
Erdbebenforscherinnen und -forscher haben die GNSS-Technik in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, um tektonische Bewegungen mit besserer räumlicher und zeitlicher Auflösung analysieren zu können. Hier knüpft das ERC-Projekt „TectoVision“ von Jonathan Bedford an. Der Forscher möchte Datenanalyse und -modellierung optimieren. Zudem soll die Installation des GNSS-Systems in Griechenland neue Erkenntnisse über vorübergehende Plattenbewegungen geben: Auf welchen Zeitskalen finden sie statt – über Minuten oder Jahrzehnte? Was sind die Auslöser für diese Bewegungen? Und wie sehr sind sie ein Zeichen dafür, dass ein Erdbeben bevorsteht? Diesen Fragen wird Jonathan Bedford mit seinem Team nachgehen.