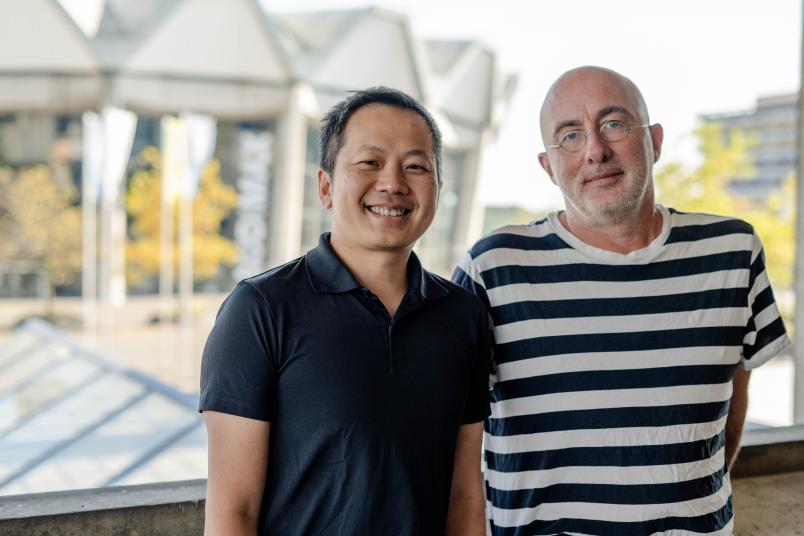
Interview
Huntington-Zentrum NRW bietet umfassende Beratung und Therapie
Was tun, wenn ein Elternteil an Huntington erkrankt ist? Möchte man wissen, ob man selbst das mutierte Gen trägt, das die Erkrankung auslösen wird? Oder lieber nicht?
Im gemeinsamen Interview erklären Prof. Dr. Carsten Saft, Leiter des klinischen Teils des Huntington-Zentrums am Universitätsklinikum St. Joseph Hospital, und der Humangenetiker der Ruhr-Universität Prof. Dr. Huu Phuc Nguyen, welche Diagnostik-, Beratungs- und Therapiemöglichkeiten am Huntington-Zentrum NRW bestehen, und geben einen Einblick in die Erforschung der unheilbaren Erkrankung.
Herr Prof. Saft, welche Symptome haben die Huntington-Patientinnen und -Patienten, die zu Ihnen kommen?
Carsten Saft: Häufig sind es Überbewegungen, also Bewegungen, die Erkrankte selbst nicht steuern können, wie zum Beispiel unbeabsichtigte Bewegungen der Arme, Beine, Hände oder Schultern. Auch der Gang wird unsicher, sodass es zu Stürzen kommen kann. Manche Patientinnen und Patienten, insbesondere die jüngeren und Kinder, leiden auch unter einer Verlangsamung der motorischen Funktionen, ähnlich wie bei der Parkinson-Erkrankung.
Wir wissen aber aus Studien und langjähriger Erfahrung, dass viele Betroffene schon Jahre vor motorischen Beschwerden an psychischen Problemen wie Depressionen oder vermehrter Reizbarkeit leiden oder dass kognitive Leistungen abnehmen. Im Kernspintomografen kann man, wenn sie wissenschaftlich ausgewertet werden, oft mehrere Jahre bis ein Jahrzehnt vorher schon erste Hirnveränderungen in bestimmten Arealen des Gehirns feststellen.
Wie verläuft die Erkrankung?
Saft: Die Symptome werden schlimmer im Verlauf. Es ist eine schwere neurodegenerative Erkrankung, die langsam fortschreitet und im Mittel etwa 15 bis 20 Jahre nach Beginn zum Tod führt – häufig durch Komplikationen wie Stürze oder Verschlucken.
Körperliche und psychische Symptome sind therapierbar
Wie helfen Sie am Huntington-Zentrum NRW?
Saft: Wir können mit Medikamenten die Symptome lindern. Inzwischen therapieren wir fast alle Patientinnen und Patienten ambulant, das sind etwa 1.000 im Jahr. Diese Art der Betreuung funktioniert gut, da die Medikamente lange brauchen, bis sie wirken.
Bei Patientinnen und Patienten, die schwerst depressiv oder aggressiv sind, ist es häufig sinnvoll, sie vor Ort in einer Psychiatrie zu behandeln. Wichtig ist mir, dass wir diese Symptome therapieren können. Wir können nicht alle Beschwerden der Krankheit behandeln, und die Medikamente haben Nebenwirkungen. Häufig lassen sich die Beschwerden aber gut lindern, sodass sich die Patientinnen und Patienten besser fühlen, auch wenn wir die Grunderkrankung und das Fortschreiten leider derzeit noch nicht bremsen können.
Bemerken die Erkrankten erste, sich langsam einschleichende Symptome selbst?
Viele Patienten nehmen erste Überbewegungen oder Wesensveränderungen gar nicht selbst wahr, sodass es häufig schon zu Problemen im sozialen Umfeld kommt, bevor die Diagnose gestellt ist: Schwierigkeiten in den Beziehungen und am Arbeitsplatz. Deshalb kann es sehr hilfreich sein, frühzeitig eine Diagnose zu stellen, um diese sozialen Probleme abzufedern.
Können Sie alle Stadien der Erkrankung therapieren?
Ja. Wir hatten in der Vergangenheit eine Versorgungslücke bei den schwer Betroffenen. Es war schwierig, ihnen schnell ein Bett anzubieten. Da sie häufig sehr unruhig sind, benötigen sie in der Regel ein Einzelzimmer, und von denen gibt es immer weniger. Vor ein paar Jahren haben wir von Gesundheitsminister Laumann für das Centrum für seltene Erkrankungen Ruhr (CeSER) Gelder überreicht bekommen. Mit einem Teil des Geldes konnten wir eine neue Station errichten, auf der wir nun vier Einzelzimmer für diese Patientinnen und Patienten zur Verfügung stellen.
Jetzt kann auch ein Angehöriger dabeibleiben. Das erleichtert nicht nur den Aufenthalt für die Patientin oder den Patienten, sondern ermöglicht es, uns Rückmeldungen zu geben, ob sich durch die Medikamentenumstellung etwas verändert hat – zum Guten oder zum Schlechten. Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen Patienten jetzt wieder besser helfen können. Dafür möchte ich mich auch bei der Selbsthilfegruppe NRW bedanken, die sich ebenfalls sehr für die Schaffung dieser Station eingesetzt hat.

Herr Prof. Nguyen, Sie untersuchen, ob jemand das krankheitsauslösende, mutierte Gen hat. Wie genau läuft die entsprechende Beratung ab?
Huu Phuc Nguyen: Beim ersten Gespräch wird nur darüber aufgeklärt, was eine Erkrankung für einen selbst und die Familie bedeutet und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Wir erwarten, dass die Patientinnen und Patienten sich Zeit nehmen, um alles zu überdenken und gegebenenfalls mit der Familie zu besprechen. Erst nach einer Bedenkzeit und einer psychologischen Beratung kann man zur Blutabnahme für den Gentest kommen. Und auch danach hat diejenige oder derjenige noch die Möglichkeit, vom Testergebnis Abstand zu nehmen.
Wir informieren die Patientin oder den Patienten nicht, wenn das Ergebnis da ist. Sie müssen von sich aus jeden einzelnen Schritt selbst gehen. Wir sagen ihnen, dass das Ergebnis nach vier Wochen da sein wird und dass sie sich dann melden können, wenn sie das möchten, oder es auch lassen können.
Seit 1993 läuft das so. Mit dieser Vorgehensweise haben wir gute Erfahrungen gemacht, ebenso mit der gemeinsamen Beratung mit den Psychologen. Wir wissen auch, dass die Mehrheit unserer Risikopatienten sich gegen die Untersuchung entscheidet. Nur schätzungsweise 20 bis 30 Prozent entscheiden sich dafür.

Wir können die Krankheit nicht heilen. Insofern ist immer die Frage, ob man das wirklich wissen möchte.
Carsten Saft
Können Träger des mutierten Gens denn den Krankheitsbeginn- oder verlauf beeinflussen?
Saft: Es gibt Empfehlungen zur Lebensführung, die wir auch in den überarbeiteten Leitlinien zu der Erkrankung nochmals zusammenfassen. So scheint körperliche und auch geistige Aktivität gut zu sein. Aber leider gibt es kein Medikament, mit dem wir die Erkrankung verzögern oder heilen könnten. Insofern ist immer die Frage, ob man wirklich wissen möchte, ob man die Veränderung geerbt hat. Es kann natürlich für die Lebens-, Familien- und Berufsplanung wichtig sein, aber auch dann muss derjenige damit klarkommen, wenn er erfährt, dass er Mutationsträger ist. Deshalb muss man sich das sehr gut überlegen. Ab dem 18. Lebensjahr kann man sich auf die Erkrankung testen lassen – auch ohne Symptome.
In welchen Lebensphasen entscheiden sich Patienten dafür?
Nguyen: Der überwiegende Teil vor der Kinderplanung. Es gibt aber viele Familien, die erfahren es erst, nachdem sie schon Kinder haben. Dann ist die Frage, was einem eine prädiktive Untersuchung hilft. Einige kommen, wenn sie 50 oder 60 sind, weil sie ihren Kindern die Situation ersparen möchten, bevor diese Kinder bekommen. Wir haben aber auch junge Patientinnen und Patienten, die mit 18 sagen: „Ich habe so lange gewartet, jetzt möchte ich es endlich wissen“.
Saft: Wir versuchen, auch bei der Entscheidungsfindung zur Seite zu stehen. Da sind oft soziale Fragen wie: Was ist mit meinem Arbeitsplatz, baue ich ein Haus schon mal behindertengerecht? Muss ich mich anders versichern? Sollte ich einen Schwerbehindertenausweis frühzeitig beantragen, damit ich einen Kündigungsschutz habe?
Deshalb bieten wir jährliche Visiten an, auch im Rahmen von Studien, damit man solche Probleme besprechen kann. Gemeinsam mit Herrn Nguyen betreuen wir ganze Familien mit erkrankten Mitgliedern, nicht nur in Hinblick auf die Krankheit, sondern auch auf die sozialen Aspekte.
Wenn ein Elternteil an Morbus Huntington erkrankt ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine Kinder ebenfalls erkranken?
Nguyen: Sie liegt bei 50 Prozent, unabhängig vom Geschlecht des Kindes. Wenn ein Elternteil das mutierte Gen weitervererbt, erkrankt das Kind, auch wenn es vom anderen Elternteil das gesunde Gen bekommt.
Dürfte denn ein Paar, bei dem ein Elternteil das mutierte Gen trägt, in Deutschland eine Präimplantationsdiagnostik (PID) durchführen lassen?
Saft: Das ist eine Einzelfallentscheidung, über die jeweils die PID-Zentren der Bundesländer auf Antrag des Paares entscheiden. Bei der PID werden Embryonen durch künstliche Befruchtung erzeugt und auf das Krankheits-verursachende Erbgut untersucht. Dies ermöglicht, nur diejenigen in die Gebärmutter einzubringen, die das mutierte Huntingtin-Gen nicht tragen und so auszuschließen, dass sie später erkranken.
Schwieriger ist die Situation, wenn schon eine Schwangerschaft besteht. In diesem Fall ist die Rechtslage momentan so, dass eine vorgeburtliche (pränatale) Untersuchung nur bei Erkrankungen möglich ist, die sich früh im Leben manifestieren. Die Huntington-Erkrankung manifestiert sich in der Regel erst spät, es gibt aber auch seltene Formen, die schon vor dem 18. Lebensjahr ausbrechen.
Humangenetische Diagnostik
Was ist Ziel Ihrer Forschung?
Saft: Wir hoffen, dass wir die Krankheit verzögern, verlangsamen, vielleicht stabilisieren können. Dass sich Symptome zurückbilden können wir, glaube ich, nicht erhoffen. Es ist noch nicht klar, ob nur das Huntingtin-Protein das Problem ist oder schon die Messenger RNA (mRNA), aus der das Protein hergestellt wird. In den vergangenen vier bis fünf Jahren haben wir an Medikamenten geforscht, die mit verschiedenen Mechanismen das Huntingtin-Protein reduzieren sollen, um so den Auslöser der Krankheit zu bekämpfen. Die unterschiedlichen Ansätze haben alle Vor- und Nachteile, die man jetzt untersuchen muss, vor allem auf Verträglichkeit in verschiedenen Dosierungen. Es hat jetzt ein paar Rückschläge gegeben, mit Nebenwirkungen, da müssen wir noch mehr lernen. Wir glauben aber, dass die Huntington-Erkrankung die am besten behandelbare unter den nicht-behandelbaren Erkrankungen ist, das müssen wir aber noch beweisen. Ich bin zuversichtlich, dass wir da weiterkommen.
Vielleicht müssen wir auch schon auf DNA-Ebene behandeln. Auch dafür gibt es Ideen wie Zinkfinger-Proteine, die bestimmte DNA-Sequenzen blockieren und so die mRNA Herstellung verhindern, und die CRISPR/Cas-Genscheren. Letztere sind aber bei der Huntington-Therapie noch weiter weg, da sie nicht nur die gewünschte Stelle in der DNA schneiden, sondern auch noch andere Stellen, die sie gar nicht schneiden sollen.
Zudem möchten wir herausfinden, ob bestimmte Wirkstoffe den Huntingtin-Proteinabbau unterstützen oder die Mitochondrien, die wichtig für die Energieversorgung der Zellen sind. Letztere funktionieren durch die Erkrankung häufig nicht mehr optimal. Außerdem erforschen wir, ob man die Krankheit über eine Beeinflussung von Immunprozessen behandeln kann.
Nguyen: Wir von der Genetik machen vor allem Grundlagenforschung, haben zum Beispiel auch das mutierte Huntingtin-Gen in Mäuse und Ratten eingebracht. An ihnen testen wir mögliche Therapiestrategien, bevor sie gegebenenfalls den Weg in die Klinik finden.
Saft: Das ist extrem hilfreich und wichtig. Es gibt viele verschiedene Tiermodelle, die der tatsächlichen Erkrankung mal mehr, mal weniger ähneln. Gerade Herr Prof. Nguyen hat Modelle entwickelt, die sehr nah an die tatsächliche Erkrankung herankommen.
Welche Medikamente erforschen Sie zur Symptomlinderung?
Saft: Viele davon sind gut bewährte oder altbekannte Medikamente. Hier kommt es im Einzelfall eher darauf an, jeweils die Verträglichkeit und Wirkung auszuprobieren und ein Medikament auch zu wechseln, sollte es nicht klappen. In den Leitlinien versuchen wir, dazu Tipps zu geben.
Mit welchen Zeiträumen müssen wir rechnen vom Studienbeginn bis zur Verfügbarkeit eines Medikaments?
Saft: Das kommt sehr auf das Medikament an. In der ersten klinischen Studienphase geht es bei wenigen Gesunden um die Nebenwirkungen. Anschließend sehen wir bei wenigen Erkrankten nach, ob zum Beispiel das Huntingtin-Gen tatsächlich unterdrückt wird – als Hinweis auf die Wirksamkeit. Da es sich um eine langsam fortschreitende Erkrankung handelt, dauert die letzte, dritte Phase dann häufig zwei bis drei Jahre, um überhaupt einen Unterschied sehen zu können zu den Patientinnen und Patienten, die keinen Wirkstoff erhalten.





