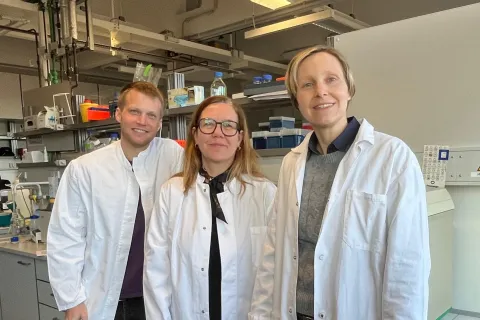Männer und Frauen reagieren unterschiedlich auf verschiedene Wirkstoffe. Zudem unterscheiden sie sich in Körpergröße, -gewicht und -oberfläche.
Studie
Männer und Frauen reagieren verschieden auf Krebstherapien
Die Universität Witten/Herdecke und die Ruhr-Universität Bochum untersuchen, wie das Geschlecht die Wirksamkeit moderner Krebstherapien beeinflusst.
Moderne Immuntherapien gelten als Durchbruch in der Krebsbehandlung: hochwirksam, aber auch komplex und teuer. Erste Studien deuten darauf hin, dass Männer und Frauen unterschiedlich darauf ansprechen. Ein Forschungsteam der Universität Witten/Herdecke (UW/H) und der Ruhr-Universität Bochum will diesen Zusammenhang nun systematisch untersuchen – gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Erstmals forschen dabei nicht nur Wissenschaftler*innen, sondern auch Betroffene selbst.
Gezielte Immuntherapien im Fokus: Wirkungsvoll, aber mit Risiken
Im Zentrum der Untersuchung stehen zwei moderne Therapieformen: die CAR-T-Zelltherapie und sogenannte T-Zell-Engager. Beide nutzen T-Zellen, also körpereigene weiße Blutkörperchen, um Krebszellen gezielt zu bekämpfen. Bei der CAR-T-Zelltherapie werden T-Zellen aus dem Blut entnommen, im Labor verändert und als gezielte Krebsjäger wieder verabreicht; sie bleiben im Körper und wirken langfristig. T-Zell-Engager hingegen sind Antikörper, die T-Zellen gezielt zu den Tumorzellen lenken, um sie zu zerstören. Ihre Wirkung ist meist zeitlich begrenzt.
„Diese Therapien haben großes Potenzial, sind aber kostenintensiv und gehen teils mit erheblichen Nebenwirkungen einher“, sagt Projektleiter Prof. Dr. Sven Schmiedl vom Lehrstuhl für Klinische Pharmakologie der UW/H. „Damit wir gezielter behandeln können, müssen wir verstehen, wie das biologische Geschlecht die Wirkung beeinflusst.“
Unterschiede bei Wirkung und Nebenwirkungen – aber das Gesamtbild fehlt
Einzelne Studien legen nahe, dass Männer zum Beispiel häufiger unter Nebenwirkungen leiden, aber teils auch stärker vom Behandlungserfolg profitieren. Frauen hingegen vertragen die Therapien häufig besser, schneiden in manchen Studien jedoch bei der Wirksamkeit schlechter ab. Eine systematische Auswertung aller verfügbaren Daten fehlt bisher – genau hier setzt das Forschungsvorhaben an, wie Dr. Blasius Liss erläutert, der als klinischer Experte das Projekt unterstützt und als Onkologe am Helios Universitätsklinikum Wuppertal arbeitet.
Geplant ist eine umfassende systematische Suche bereits durchgeführter Studien und eine Meta-Analyse auf Basis individueller Patientendaten aus diesen Studien. Ziel ist es, geschlechtsspezifische Unterschiede bei Wirksamkeit, Nebenwirkungen und Lebensqualität sichtbar zu machen.
Betroffene bringen eigene Perspektive ein
Eine Patientin und ein Patient begleiten das Projekt als sogenannte Co-Forschende. Sie wirken mit bei der Entwicklung von Fragestellungen, der Bewertung der Studien, der Ergebnisdiskussion und der Entwicklung verständlicher Informationsmaterialien.
„Gerade bei Themen wie Lebensqualität, Erschöpfung oder langfristigen Belastungen ist es entscheidend, die Sicht der Betroffenen einzubeziehen“, erklärt Prof. Dr. Nina Timmesfeld, Leiterin der Abteilung für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie an der Ruhr-Universität Bochum. „Sie können wertvolle Hinweise geben, was in der Versorgung tatsächlich zählt – über medizinische Kennzahlen hinaus.“
Macht die Dosierung einen Unterschied?
Auch Unterschiede in Körpergewicht, Körperzusammensetzung und Körperoberfläche könnten eine Rolle spielen. Denn manche Wirkstoffe werden unabhängig vom Körpergewicht verabreicht, andere gewichtsabhängig dosiert. Ob das in der Praxis zu geschlechtsspezifischen Effekten führt, ist bislang kaum erforscht.
„Uns geht es auch darum, potenzielle blinde Flecken aufzudecken – etwa, wenn Dosierungsempfehlungen für alle gelten, obwohl sie nicht für Männer und Frauen gleichermaßen passen“, betont Prof. Dr. Petra Thürmann, Vizepräsidentin für Forschung der UW/H und Expertin für geschlechts- und genderbezogene Arzneimitteltherapie. „Hier könnten sich Ansatzpunkte für eine individuellere und sicherere Therapie ergeben.“
Wissenschaft für die Praxis nutzbar machen
Die Ergebnisse sollen in Fachjournalen veröffentlicht, auf Kongressen vorgestellt und für die Öffentlichkeit verständlich aufbereitet werden. Geplant sind eine Projektwebseite sowie Informationsmaterialien für Patient*innen.
Langfristig sollen die Erkenntnisse in medizinische Leitlinien einfließen – insbesondere sofern sich herausstellt, dass eine geschlechtsspezifisch angepasste Dosierung oder Überwachung sinnvoll ist. „Wir wollen klinisch relevante Hinweise liefern, die Ärzt*innen und Patient*innen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen“, so Schmiedl. „Denn das Ziel ist eine Krebstherapie, die so individuell ist wie die Menschen, die sie betrifft.“