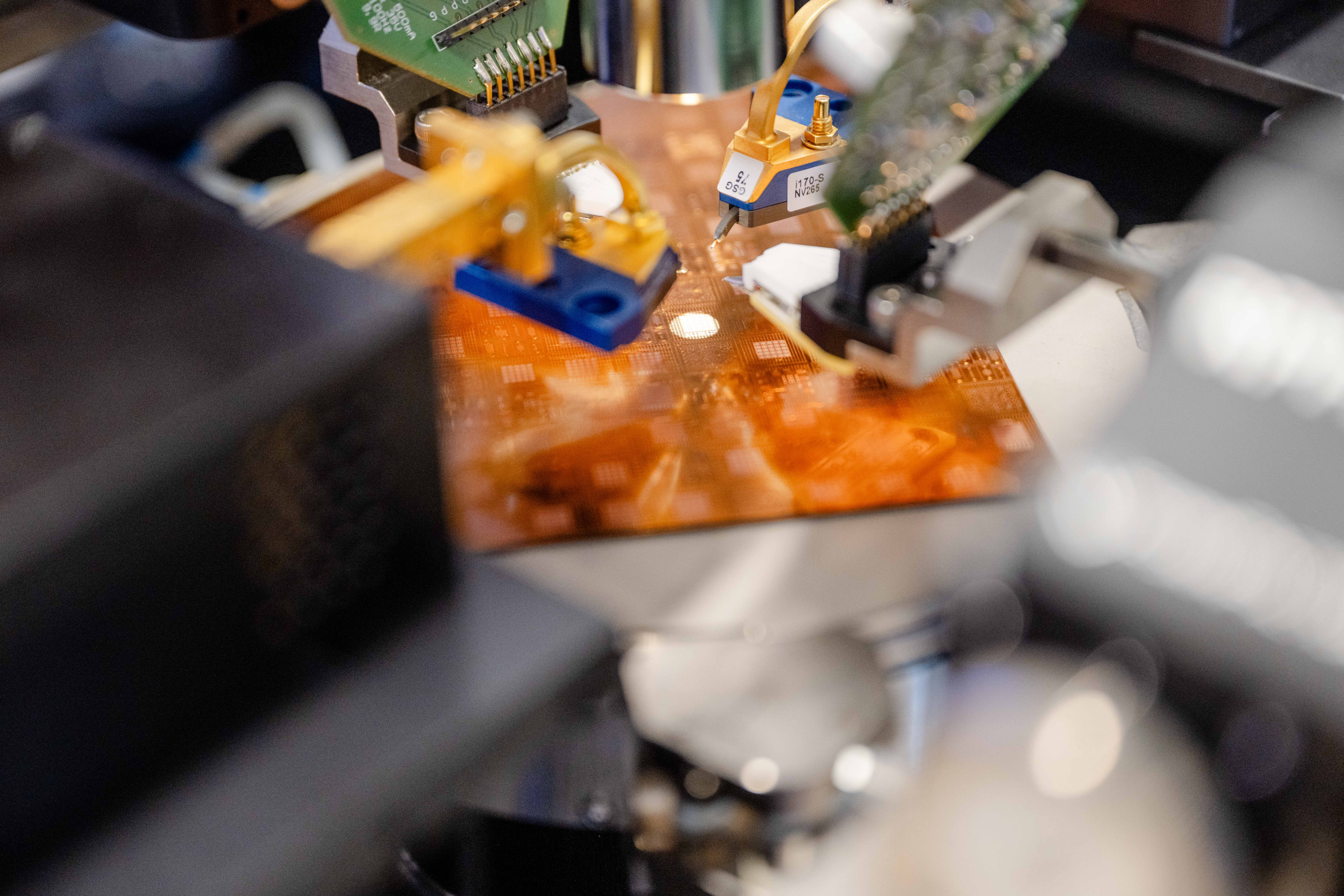Staublunge Die zähen Anfänge von Arbeitsschutz und Versicherungswesen
Als Bergleute kamen nur die Fittesten der Fitten infrage. Jahre später fanden sich viele als Todgeweihte wieder. Daniel Trabalski erzählt in seiner Doktorarbeit die Geschichte der Krankheit.
Wie sich Arbeitschutz und Versicherungswesen rund um die Staublunge der Bergleute entwickelt haben, hat Historiker Daniel Trabalski in seiner Doktorarbeit am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Ruhr-Universität Bochum rekonstruiert. Über seine Forschung, die auch die Perspektive der Betroffenen schildert, berichtet das Bochumer Wissenschaftsmagazin Rubin. Trabalskis Arbeit erfolgt im Rahmen des Projektes „Partizipative Risikopolitik?“, das die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert und das am Deutschen Bergbaumuseum angesiedelt ist.
Gefahren lauerten im Bergbau nicht nur in Form von Unfällen, wobei anfangs nur diese versichert waren. Erst ab 1925 deckte die Berufskrankheitenverordnung auch einige chronische Krankheiten ab. Die Staublunge, auch Silikose genannt, kam erst 1929 hinzu, und auch dann war nur das schwerste von drei Krankheitsstadien versichert.
Kein Arbeitsschutz während der Weltkriege
Erste zaghafte Bemühungen des Arbeitsschutzes unter Tage wurden durch den Zweiten Weltkrieg jäh unterbunden. Das System war auf maximale Produktion ausgelegt, weil man Kohle brauchte, um Stahl und Treibstoff herzustellen. Folglich stiegen die Unfallzahlen, und auch die Zahl der Silikose-Betroffenen schnellte in die Höhe. Als das nach 1945 auffiel, expandierten die Silikose-Forschungsinstitute und eine starke Wissensproduktion setzte ein. Es wurden technische Maßnahmen ergriffen, um den Staubgrad bei der Bergarbeit zu verringern. Die Zahl der Neuerkrankten ging dadurch Ende der 1950er-Jahre zurück.
Die fünfte Berufskrankheitenverordnung aus dem Jahr 1952 sorgte außerdem dafür, dass Betroffene nicht nur im schwersten Krankheitsstadium Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen konnten, sondern bereits ab einem Invaliditätsgrad von 20 Prozent. Von den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre gab es konstant rund 50.000 Menschen mit anerkannter Silikose, die eine Rente bezogen.
Statistische Methoden liefern neue Erkenntnisse
Bis zum Beginn der 1960er-Jahre verfolgte man die Idee, dass bestimmte Menschen schneller an einer Staublunge erkrankten als andere. Anfang der 1950er-Jahre hatte das Oberbergamt eine Kartei eingeführt, in der systematisch für jeden Bergmann erfasst war, an welchen Betriebspunkten er arbeitete und wie hoch dort die Staubbelastung war. Doch erst nach einer statistischen Analyse in den 60er-Jahren fiel auf, dass die Zeit, die ein Bergmann unter starker Staubbelastung gearbeitet hatte, mit seinem Gesundheitszustand zusammenhing.
Nun schaute man nicht mehr auf den individuellen Bergmann und seine vermeintliche Neigung, eine Silikose zu entwickeln. Stattdessen berechnete man die Wahrscheinlichkeit für eine Silikose-Erkrankung basierend auf der Staubmenge, der ein Bergmann im Lauf seiner Arbeitszeit ausgesetzt gewesen war, und setzte Grenzwerte für die Staubexposition fest.
Tiefe Einblicke in das häusliche Elend
Aktuell sichtet Daniel Trabalski Akten aus der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger, um zu beleuchten, was der Umgang der Versicherungen mit den Silikose-Fällen für die Betroffenen bedeutete. Häufig ging es dabei um Forderungen nach Pflegegeld oder einer höheren Rente. „Bislang konnte ich nur wenige Äußerungen aus den Akten sammeln, aber sie geben teils tiefe Einblicke in das häusliche Elend, das sich abspielte“, schildert er. Die ehemaligen Bergleute waren frustriert darüber, dass sie an den Folgen der Arbeit unter Tage schwer erkrankt waren und dann um Versicherungsleistungen ringen mussten.
Der Bochumer Historiker zieht ein Zwischenfazit: „Es klafft eine Lücke zwischen dem Selbstbild der Bergleute als hart arbeitende, kernige Typen und dem Zustand des siechen Todgeweihten, in dem sie sich Jahrzehnte später wiederfanden“, sagt Trabalski. „Für die Betroffenen scheint das eine sehr große Demütigung gewesen zu sein.“