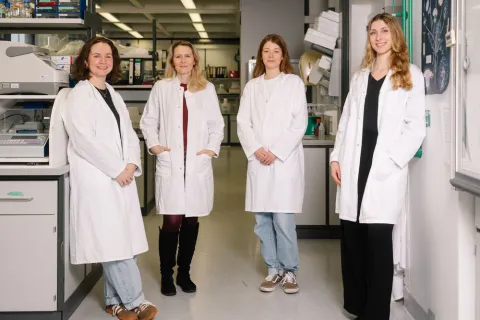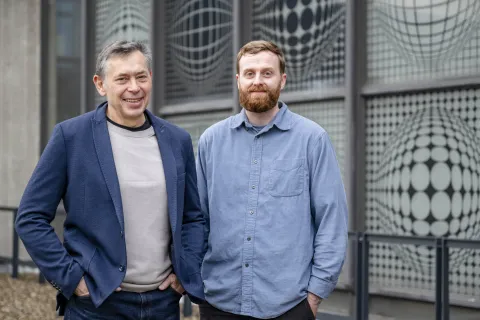Medizinische Ethik
Arbeit zur Einwilligungsfähigkeit wird ausgezeichnet
Wie stellt man fest, ob jemand, der eine psychische Störung hat, einwilligungsfähig ist oder nicht? Viele Ansätze sind diskriminierend, nur einer nicht.
Eine psychische Erkrankung bedeutet nicht unbedingt, dass Betroffene nicht einwilligungsfähig sind, wenn es zum Beispiel um medizinische Behandlungen geht. Für die Feststellung der Einwilligungsfähigkeit gibt es verschiedene Ansätze. Dr. Matthé Scholten vom Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin der Ruhr-Universität Bochum (RUB) hat diese Ansätze daraufhin geprüft, ob sie diskriminierend gegenüber Menschen mit einer psychischen Störung sind. Für seine Arbeit, die er gemeinsam mit Dr. Jakov Gather und Prof. Dr. Dr. Jochen Vollmann verfasst hat, wurde er mit dem mit 6.000 Euro dotierten Preis für Philosophie und Ethik in Psychiatrie und Psychotherapie ausgezeichnet. Der Preis wird von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde gemeinsam mit der Stiftung für Seelische Gesundheit und dem Bonner Institut für Wissenschaft und Ethik verliehen.
Diskriminierend gegenüber Menschen mit psychischen Störungen
Einwilligungsfähigkeit ist nach gängiger Auffassung eine notwendige Voraussetzung für eine gültige informierte Einwilligung zum Beispiel in eine Behandlung oder die Teilnahme an einer Studie. Ist eine Patientin oder ein Patient in Bezug auf eine bestimmte medizinische Entscheidung nicht einwilligungsfähig, muss ein Stellvertreter die Entscheidung im Sinne des Patienten oder der Patientin treffen.
Deutschland hat 2009 die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) ratifiziert. Folgt man dem Kommentar des Fachausschusses, beinhaltet sie, dass „Vertragsstaaten verpflichtet sind, Stellvertretern nicht zu gestatten, eine Einwilligung für Menschen mit Behinderungen zu erteilen.” Der Fachausschuss der UN-BRK begründet diese Forderung damit, dass das Konzept der Einwilligungsfähigkeit inhärent diskriminierend gegenüber Menschen mit psychischen Störungen sei. In der prämierten Arbeit untersuchen Matthé Scholten und seine Koautoren, inwiefern die verschiedenen Modelle von Einwilligungsfähigkeit diskriminierend sind.
Diagnose, unvernünftige Entscheidung oder Fähigkeit
„Wir gehen dabei auf den sogenannten status approach ein, der die Einwilligungsunfähigkeit aufgrund einer Diagnose festlegt, auf den sogenannten outcome approach, der sie aufgrund der Unvernünftigkeit einer Entscheidung festlegt, und auf den sogenannten functional approach, also ein fähigkeitsbasiertes Modell“, erklärt Matthé Scholten. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass ausschließlich letzteres Modell nicht diskriminierend ist, da es keine ungleiche Behandlung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe impliziert und Personen mit psychischen Störungen durch die Anwendung des Modells keinem relativen Nachteil ausgesetzt sind.
„Man sollte grundsätzlich davon ausgehen, dass Menschen mit zum Beispiel einer Schizophrenie, bipolaren Störung oder leichtgradigen Demenz einwilligungsfähig sind und selbst Entscheidungen über ihre medizinische Behandlung treffen können. Erst, wenn sich in einer Beurteilung herausstellt, dass gewisse Entscheidungsfähigkeiten erheblich beeinträchtigt oder aufgehoben sind, liegt eine Einwilligungsunfähigkeit in Bezug auf eine bestimmte Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt vor“, so der Preisträger.