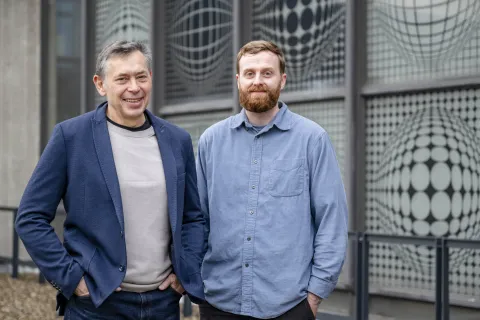Psychologie
Warum stressige Erlebnisse besser erinnert werden
Wenn das Gehirn Erinnerungen an Objekte abspeichert, erzeugt es für jedes davon ein charakteristisches Aktivitätsmuster. Stress verändert diese Gedächtnisspuren.
Stressige Erlebnisse werden meist besser erinnert als neutrale Erlebnisse. Warum das so ist, haben Forschende der Ruhr-Universität Bochum (RUB) untersucht. Mithilfe von fiktiven Bewerbungsgesprächen brachten sie Personen in stressige Situationen und erfassten anschließend ihre Erinnerung an Gegenstände aus dem Bewerbungsgespräch. Mittels funktioneller Magnetresonanztomografie analysierten sie die Gehirnaktivität, während die Teilnehmenden die Objekte erneut sahen. Erinnerungen an Objekte aus stressigen Situationen scheinen dabei auf einer ähnlichen Gehirnaktivität zu beruhen wie Erinnerungen an den Stressauslöser selbst.
Die Ergebnisse beschreibt das Team um Anne Bierbrauer, Prof. Dr. Oliver Wolf und Prof. Dr. Nikolai Axmacher vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft der RUB in der Zeitschrift Current Biology, online veröffentlicht am 14. Oktober 2021.
Unterschiedliche Theorien
„Von stressigen Erlebnissen, etwa der eigenen Führerscheinprüfung, hat man in der Regel auch nach vielen Jahren detaillierte Bilder vor Augen“, sagt Oliver Wolf. „Einen Spaziergang durch den Park am gleichen Tag vergisst man hingegen schnell wieder.“ Woran das liegt, interessiert die Neurowissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der RUB.
Frühere Studien und theoretische Überlegungen hatten zu unterschiedlichen Vorhersagen geführt, wie sich Erinnerungen an stressige Erlebnisse von neutralen unterscheiden: „Einerseits hätten sehr unterschiedliche Gedächtnisrepräsentationen der Schlüssel zu stärkeren Erinnerungen sein können, andererseits sprach einiges dafür, dass Stresserinnerungen eine höhere Ähnlichkeit aufweisen“, sagt Anne Bierbrauer. Die aktuelle Studie liefert Hinweise für die zweite Theorie.
Stressige Erlebnisse im Labor untersuchen
Anders als in vielen Laboruntersuchungen wollten die Forschenden in ihrem Experiment die Erinnerungsspur an ein reales Ereignis erfassen. Zu diesem Zweck griffen sie auf den sogenannten Trier Social Stress Test zurück. Dabei müssen die Teilnehmenden vor einem Bewerbungskomitee sprechen, das neutral schaut und kein positives Feedback gibt. Der Test löst bei den Teilnehmenden zuverlässig Stress aus.
Während der Bewerbungssituation benutzte das Komitee eine Reihe von Alltagsobjekten; eines der Komitee-Mitglieder trank etwa einen Schluck aus einer Kaffeetasse. In einer Kontrollgruppe waren Probandinnen und Probanden mit den gleichen Objekten konfrontiert, aber keinem Stress ausgesetzt. Am Tag nach dem Test zeigten die Forschenden den Teilnehmenden beider Gruppen die Objekte, während sie die Gehirnaktivität im Magnetresonanztomografen aufzeichneten. Die gestressten Teilnehmenden erinnerten sich besser an die Objekte als Personen aus der Kontrollgruppe.
Die Forschenden analysierten vor allem die Gehirnaktivität in der Amygdala, einer Region, die unter anderem für das emotionale Lernen wichtig ist. Sie verglichen die neuronalen Spuren von Objekten, die in der Stresssituation von den Komitee-Mitgliedern verwendet worden waren, mit denen von Objekten, die nicht verwendet worden waren. Das Ergebnis: Die Gedächtnisspuren von verwendeten Objekten waren ähnlicher zueinander als von nicht verwendeten Objekten. Dies war in der Kontrollgruppe nicht der Fall. Anders gesagt waren die Gehirnrepräsentationen der Objekte aus den Stresssituationen sehr eng miteinander verbunden und somit von anderen Erlebnissen abgegrenzt.
Stressige Erinnerungen beruhen auf ihrer Ähnlichkeit zum Stressor
Die Forschenden zeigten den Probanden am Tag nach dem Stresstest nicht nur Bilder der Objekte aus der Bewerbungssituation, sondern auch Fotos von den Personen des Bewerbungskomitees. Die Probandinnen und Probanden erinnerten insbesondere diejenigen Objekte, deren Gehirnaktivität ähnlich zu der Aktivität war, die durch die Präsentation der Komitee-Mitglieder ausgelöst wurde. „Die Komitee-Mitglieder lösten in der Interviewsituation den Stress aus. Es scheint also so zu sein, dass die Verbindung zwischen den Objekten und den Stressauslösern ausschlaggebend für die verbesserte Erinnerung war“, folgert Nikolai Axmacher.
Die Erkenntnisse, die in dieser Studie gewonnen wurden, sprechen – zumindest für emotionale oder stressige Erinnerungen – gegen die Theorie, dass stärkere Erinnerungen durch möglichst unterschiedliche Gedächtnisrepräsentationen ausgelöst werden. Der Mechanismus, der emotionale Erinnerungen verstärkt, scheint vielmehr darauf zu beruhen, dass die wichtigen Aspekte der Episode auf neuronaler Ebene aneinandergebunden und ähnlicher zum Stressauslöser werden. „Dieses Resultat könnte ein wichtiger Baustein sein, um emotionale und traumatische Erinnerungen besser zu verstehen“, so Anne Bierbrauer.