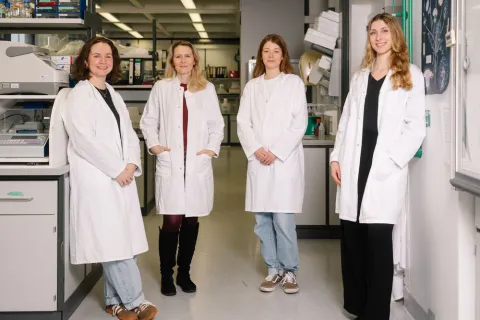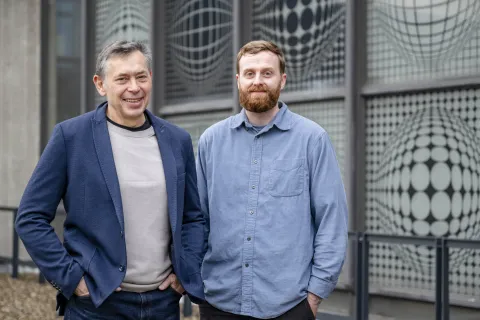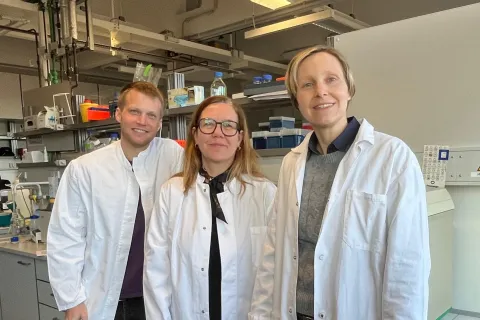Psychologie
Wie Computer helfen können, Traumata zu verarbeiten
Computertrainings unterstützen Betroffene in der Therapie ihrer Trauma-Symptome. Forschende sehen darin ein großes Potenzial für eine niedrigschwellige Unterstützung der Behandlung von Traumafolgen.
Ein traumatisches Erlebnis kann Betroffene noch lange beschäftigen und ihr ganzes Leben beeinträchtigen. Neue Studien untersuchen die Wirkung von Computertrainings, unter anderem als Ergänzung zu einer Therapie, um Traumafolgen wie wiederkehrende belastende Bilder und Eindrücke der traumatischen Erfahrung zu behandeln. Ein Team der Psychologie der Ruhr-Universität Bochum und der Ludwig-Maximilians-Universität München hat die entsprechende Forschungsliteratur ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, dass computergestützte, kognitive Trainings vielversprechende erste Ergebnisse geliefert haben. Sie berichten in der Zeitschrift Verhaltenstherapie vom 7. Juni 2022.
Wenn die Bilder immer wieder kommen
Nach einer Situation, die mit intensiver Angst und vielleicht sogar Lebensgefahr einhergeht, haben manche Betroffene noch Wochen, Monate oder sogar Jahre später damit zu kämpfen. Sie leiden unter anderem unter sogenannten Intrusionen: Sie erleben intensive Erinnerungen an das Trauma, die sich anfühlen, als würde das Trauma im Hier und Jetzt wieder stattfinden. Solche Intrusionen können sehr überwältigend sein und gehen mit starken negativen Emotionen einher. Halten solche Symptome mehr als einen Monat an, sprechen Expertinnen und Experten von einer Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). „Die kognitiven Modelle der Posttraumatischen Belastungsstörung gehen davon aus, dass den Symptomen eine veränderte und vor allem dysfunktionale Informationsverarbeitung zugrunde liegt“, erklärt Prof. Dr. Marcella Woud, Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin in der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie der RUB.
Entscheidend dafür, wie die Betroffenen mit traumatischen Erfahrungen zurechtkommen, scheint unter anderem zu sein, wie sie das Ereignis, aber auch ihre Reaktion und Symptome, bewerten. „Intrusionen sind sehr belastend und lösen häufig intensive Angst aus. Sie sind allerdings Teil einer normalen Reaktion auf ein sehr belastendes Ereignis. Deuten Betroffene Intrusionen als ein Zeichen dafür, dass sie das Ereignis nicht bewältigen können, versuchen sie häufig, das Auftreten von Intrusionen zu verhindern und Gedanken daran zu unterdrücken. Langfristig hat dies jedoch einen paradoxen Effekt und führt leider dazu, dass die Intrusionen eher zunehmen“, erklärt Felix Würtz, Doktorand der RUB-Psychologie.
Um solche negativen Bewertungsmuster zu reduzieren und hilfreichere Bewertungen aufzubauen, testen Forschende aktuell verschiedene Computertrainings, so auch das RUB-Team. Die Strategie der sogenannten Cognitive Bias Modification (CBM) besteht darin, die Patientinnen und Patienten Sätze mit Bezug auf das Trauma vervollständigen zu lassen und ihnen so eine positive Deutung nahezulegen. Ein Beispiel: „Ich muss ständig an das Trauma denken, das zeigt mir, dass ich es ... aufar_eite.“ Gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und -partnern testeten sie das Instrument in einer randomisierten kontrollierten klinischen Studie mit 80 Patientinnen und Patienten, die stationär wegen ihrer PTBS behandelt wurden. Die Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung: Patientinnen und Patienten, die an dem Bewertungstraining teilgenommen hatten, bewerteten Traumasymptome wie Intrusionen und ihre Gedanken bezüglich des Traumas anschließend weniger negativ als Angehörige der Kontrollgruppe.
Forschung ist lohnenswert
Gemeinsam mit Privatdozentin Dr. Charlotte Wittekind von der Ludwig-Maximilians-Universität München haben Woud und Würtz die verfügbare wissenschaftliche Literatur zum Thema CBM bei PTBS analysiert. Diese Analyse bezieht sich nicht nur auf Bewertungstrainings, sondern beschreibt auch Verfahren, die zum Beispiel dysfunktionale kognitive Prozesse im Bereich der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses trainieren. Dies basiert auf Studien, die gezeigt haben, dass Patientinnen und Patienten auch in diesem Bereich eine verzerrte Informationsverarbeitung haben – so richten PTBS-Patientinnen und -Patienten ihre Aufmerksamkeit schneller auf bedrohliche als auf neutrale Reize beziehungsweise haben größere Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit von traumarelevanten Reizen zu lösen. In einem Aufmerksamkeitstraining lernen sie somit, ihre Aufmerksamkeit umzulenken, also zum Beispiel weg von den bedrohlichen und hin zu den neutralen Reizen.
„In der Gesamtschau konnten wir feststellen, dass Verfahren, die sich auf die Modifikation von dysfunktionalen, traumarelevanten kognitiven Prozessen richten, durchaus ein Potenzial für den Einsatz in der Behandlung haben, beispielsweise um das Erlernte in der Therapie zu festigen“, fasst Marcella Woud zusammen. „Weitere Forschungsarbeit daran ist auf jeden Fall nötig, aber vor allem lohnenswert.“