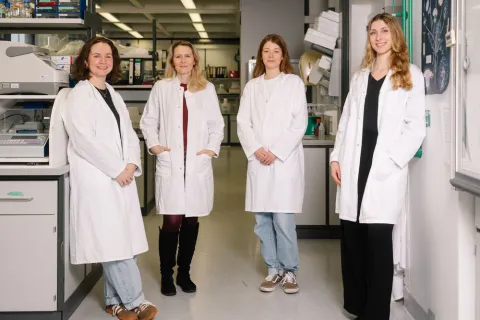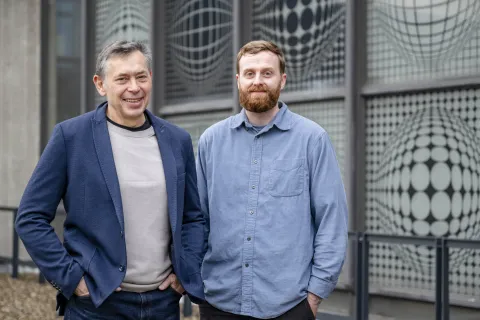Psychologie
Wenn die Bilder immer wieder kommen
Viele Betroffene empfinden ein Trauma als etwas, das sie nie wieder loslassen wird. Forschende der RUB steuern dagegen. Mit einem einfachen Computertraining.
Plötzlich ist alles wieder da: die Dunkelheit, knirschende Schritte auf dem Weg, der kalte Wind im Gesicht, das Rauschen in den Blättern, die raue Stimme, Hände, die sie packen, die spitzen Aschekörnchen des Gehwegs, ein Schlag, der Schmerz. Wäre sie bloß nicht nachts durch den dunklen Park nach Hause gegangen!
Traumatische Erlebnisse wie ein nächtlicher Überfall verfolgen manche Opfer noch Wochen, Monate oder gar Jahre später. Intensive Angst, Verletzungen, vielleicht sogar Lebensgefahr hinterlassen Spuren. Das ist in gewissem Maße normal. „Opfer von Gewaltverbrechen haben häufig später noch sogenannte Intrusionen, durchleben das Geschehene plötzlich erneut“, erklärt Prof. Dr. Marcella Woud. Die Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin in der Arbeitseinheit Klinische Psychologie und Psychotherapie der RUB beschäftigt sich im Rahmen ihrer Forschung mit der Behandlung unter anderem von Posttraumatischen Belastungsstörungen, kurz PTBS. Davon spricht man erst, wenn die Symptome länger als vier Wochen nach dem auslösenden Ereignis anhalten.

Ob es dazu kommt, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Menschen mit wenig sozialer Unterstützung leiden häufiger daran als solche mit einem funktionierenden sozialen Netzwerk. „Aber es kommt vor allem darauf an, welchen Menschen in welcher Situation seines Lebens und mit welchen Ressourcen zur Stressbewältigung welche traumatische Situation trifft, und wie all dies dann bewertet wird“, unterstreicht Marcella Woud. Bei einigen genügt es, Augenzeuge einer Gefahrensituation gewesen zu sein, während andere einen Bankraub überleben und keine PTBS entwickeln.
Wie ein übervoller Kleiderschrank
„Man kann sich den Prozess im Gehirn bei einer traumatischen Situation so vorstellen“, erklärt Felix Würtz, Doktorand in der RUB-Psychologie: „Während der Situation findet eine Reizüberflutung statt, und das Gehirn – das in einer Art Überlebensmodus ist – versucht, alle Eindrücke festzuhalten, um für mögliche ähnliche Situationen bestmöglich gewappnet zu sein.“ Diese vielen Reize werden jedoch nicht gut verarbeitet. Das Erlebnis erscheint buchstäblich unglaublich und kann nicht in bestehende Informationen des Gedächtnisses einsortiert werden. Die Erinnerung daran ist oft konfus, die Chronologie durcheinander, die sensorischen Erfahrungen werden als überwältigend beschrieben. Somit funktioniert die Speicherung des Erlebten schlecht. In der Folge kommt es unter anderem zu Intrusionen. „Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einen riesigen Haufen Kleider in einen Schrank stopft und die Tür schnell zumacht. Öffnet man sie dann auch nur einen kleinen Spalt, quillt sofort alles auf einmal wieder heraus“, erläutert der Psychologe.
Entscheidend dafür, wie die Betroffenen mit solchen Erfahrungen zurechtkommen, scheint unter anderem zu sein, welche Gedanken sie sich nach dem Ereignis machen. Ganz wichtig ist, wie sie das Ereignis, aber auch ihre Reaktion und Symptome bewerten. Schwierig wird es, wenn zum Beispiel Symptome als Zeichen dafür interpretiert werden, dass das Trauma einen für immer zerstört hat, und dass man ständig auf der Hut vor neuen Gefahren sein muss. Ein Beispiel ist der Gedanke: „Diese Flashbacks sind ein Zeichen dafür, dass ich das Erlebnis niemals verkraften und verarbeiten werde.“
Das Ereignis ist ständig gegenwärtig
Solche Bewertungen resultieren in einem ungünstigen Verhalten. Betroffene nehmen die ganze Welt als Bedrohung wahr, sind in einem permanenten Zustand der Anspannung und äußersten Vorsicht. Das auslösende Ereignis, etwa der Überfall im Park, ist für sie nicht vergangen, sondern ständig gegenwärtig. Opfer vermeiden Situationen aus Angst vor einem Kontrollverlust, manche können aus diesem Grund zum Beispiel nicht über das Erlebnis reden. „Dadurch können sie aber auch keine korrigierenden Erfahrungen machen“, gibt Marcella Woud zu bedenken. Das ebnet den Weg in eine posttraumatische Belastungsstörung oder auch in eine Depression, die häufig mit Selbstvorwürfen einhergeht: Warum habe ich nur diesen Weg genommen? Oft kommen auch beide Störungen gemeinsam vor.
Um Betroffenen zu helfen, setzen Marcella Woud und ihre Kolleginnen und Kollegen auf die (traumafokussierte) Kognitive Verhaltenstherapie. Dabei geht es einerseits um die Konfrontation mit der als bedrohlich erlebten Situation. Ziel ist es, Erfahrungen zuzulassen, die eben nicht die Ängste und negativen Gedanken bestätigen, sondern belegen: Es muss kein Kontrollverlust stattfinden. Ich bin stark genug, mich der Situation in der Therapie zu stellen und dies durchzustehen.
Es gibt auch eine andere Sichtweise
Zum anderen widmen sich die Therapeutinnen und Therapeuten gezielt den Gedanken über das Ereignis und den Bewertungen des Ereignisses und der Reaktionen darauf. Sie zeigen den Betroffenen auf, dass es auch andere Möglichkeiten der Bewertung gibt: Plötzliche Erinnerungen an das traumatische Ereignis sind eine normale Reaktion der Verarbeitung des Erlebten und kein Zeichen dafür, dass man nie darüber hinwegkommen wird. Dabei kommt es darauf an, dass die Patientinnen und Patienten selbst auf die alternative Interpretation kommen. Und sie muss ihnen glaubhaft erscheinen. „Anfangs nimmt man die Betroffenen noch ein wenig mehr an die Hand, lässt dann aber immer mehr Freiraum für eigene Gedanken“, beschreibt Marcella Woud das therapeutische Vorgehen.
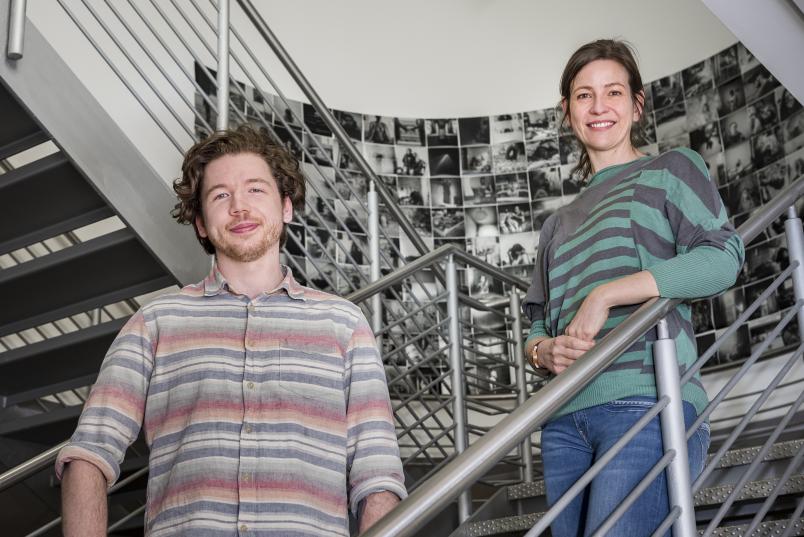
Unterstützend haben die Forschenden der RUB ein Computertraining entwickelt, das Betroffene begleitend zur Therapie machen können. Gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und -partnern testeten sie das Instrument in einer randomisierten kontrollierten klinischen Studie mit 80 Patientinnen und Patienten, die stationär wegen ihrer PTBS behandelt wurden. Mit dem Interpretationstraining lernten die Betroffenen, wiederkehrende und belastende Traumasymptome weniger stark negativ zu bewerten und stattdessen als normal und Teil der Verarbeitung anzusehen.
Systematisch positiver bewerten
Bei dem Training bekamen die Teilnehmenden Aussagen gezeigt, die sie vervollständigen mussten. Zum Beispiel: „Ich glaube, anderen Menschen zu vertrauen wird für mich irgendwann ... mö_lich sein.“ Oder: „Ich muss ständig an das Trauma denken, das zeigt mir, dass ich es ... aufar_eite.“ Aufgabe war es, die fehlenden Buchstaben des Wortfragments zu ergänzen und damit den Sätzen systematisch eine positive Bewertung zu geben. Im Laufe der Zeit wurden die Aussagen noch stärker positiv gefärbt, zum Beispiel: „Ich weiß jetzt, dass schlimme Zeiten im Leben … vorü_ergeh_n.“ oder „Während des Traumas musste ich schnell reagieren. Das, was ich getan habe war … ri_htig.“
Etwa die Hälfte der Teilnehmenden absolvierte dieses „Cognitive Bias Modification Appraisal“-Training, die andere Hälfte bekam ein Placebo-Kontrolltraining. Beide Trainings fanden in den ersten beiden Wochen der stationären Behandlung in der Klinik statt, mit jeweils vier 20-minütigen Sitzungen pro Woche. Während sowie nach dem Klinikaufenthalt wurden verschiedene Messungen vorgenommen, um Symptomveränderungen zu erfassen.
Die Ergebnisse geben Anlass zur Hoffnung: Patientinnen und Patienten, die an dem Interpretationstraining teilgenommen hatten, bewerteten Traumasymptome wie Intrusionen und ihre Gedanken bezüglich des Traumas anschließend weniger negativ als Angehörige der Kontrollgruppe. Auch zeigten sie in verschiedenen zusätzlichen Testverfahren weniger Symptome. „Wir schließen daraus, dass das Training zu funktionieren scheint, zumindest konnten wir kurzfristige Effekte nachweisen“, resümiert Marcella Woud.
Langfristige Wirkung ist ungeklärt
Was die Forschenden noch nicht wissen, ist, wie sich das Training langfristig auswirkt. „Neu zu denken ist schwierig“, so Marcella Woud. „Man neigt dazu, doch immer wieder auf den alten Trampelpfad der Gedanken einzubiegen.“ Weitere Studien müssten daher zeigen, wie solche Trainings langfristig wirken, etwa nach drei Monaten, oder sogar ein bis zwei Jahren. Auch ob es Wirkung zeigt, wenn die Betroffenen nach der Entlassung aus der Klinik mit dem Online-Training weitermachen.
„Die dysfunktionale Bewertung ist ein transdiagnostisches Symptom, das heißt, es spielt bei fast allen psychischen Störungen eine Rolle“, sagt Marcella Woud. Umso lohnenswerter ist es, das Umdenken zu trainieren. Im Rahmen ihrer Emmy-Noether-Gruppe und dem Sonderforschungsbereich 1280 zum Thema Extinktionslernen wird sich ihre zukünftige Forschung genau hierauf richten – mittels experimenteller Grundlagen- sowie klinisch-angewandter Forschung.