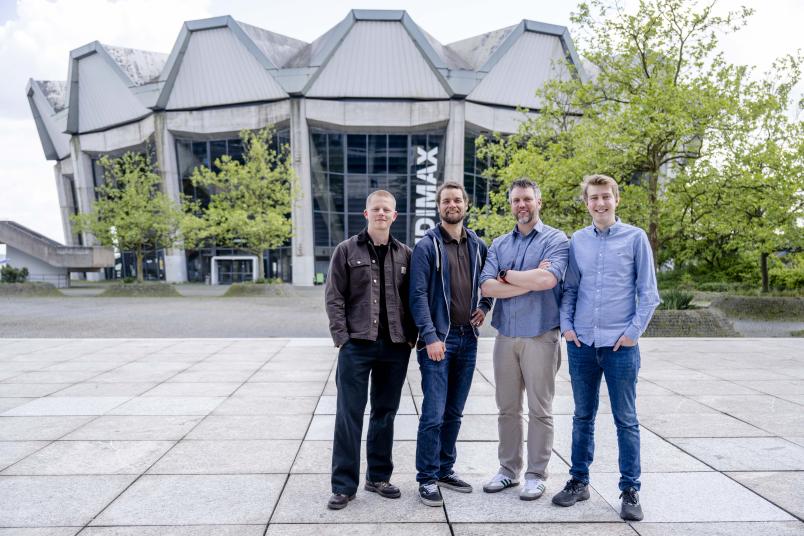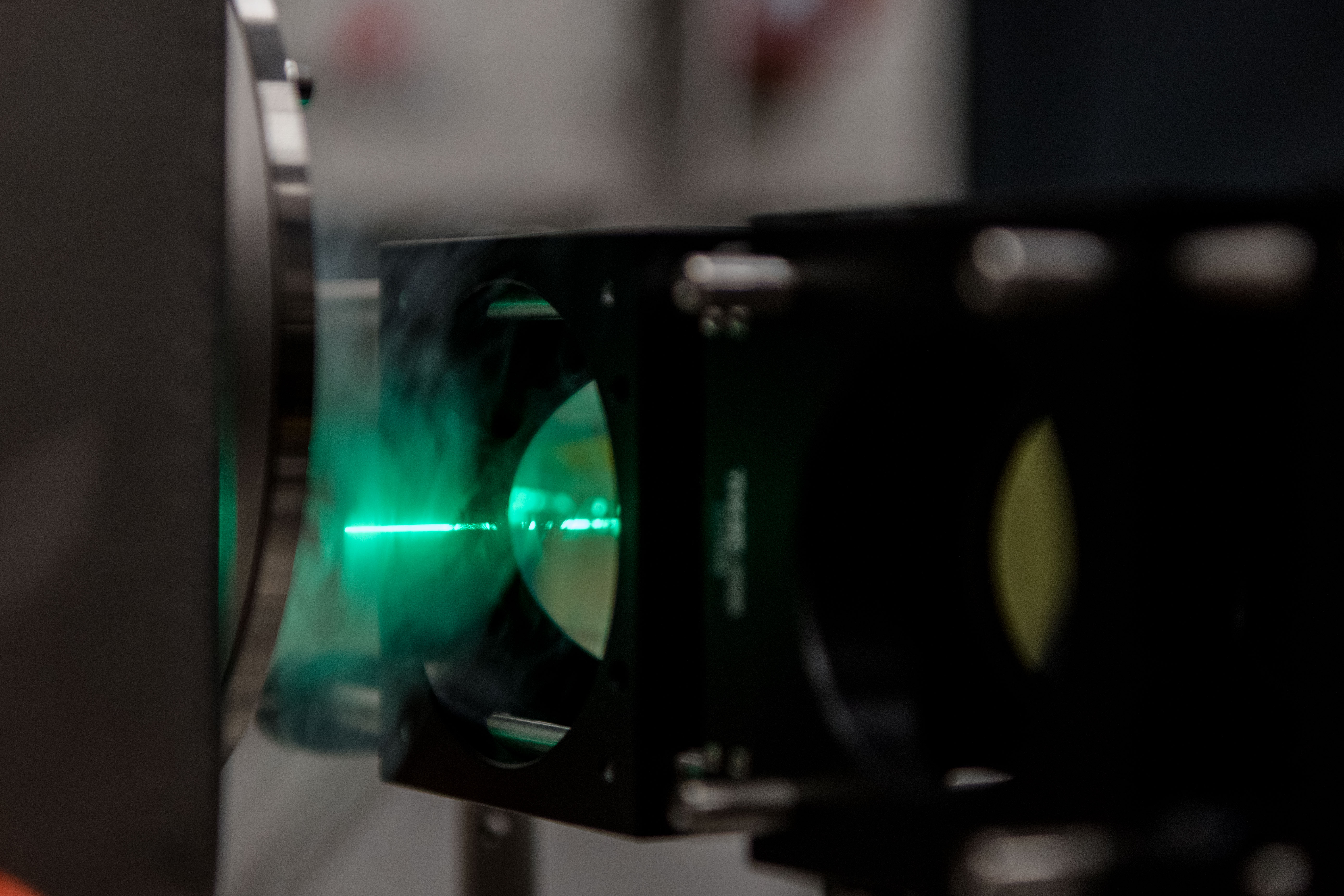Kommentar
Deutsches Hochschulsystem agiert gegen den eigenen Nachwuchs
Das deutsche Hochschulsystem bietet Nachwuchskräften wenig Planungssicherheit, kaum Möglichkeiten zur strategischen Karriereentwicklung und zwingt viele Forscher, die eigene Universität zu verlassen. Sinnvoll?
Das deutsche Universitätssystem kämpft mit zahlreichen strukturellen und politischen Herausforderungen. In Sachen Personalrekrutierung kämpft es derzeit aber eher zu wenig um den Wissenschaftsnachwuchs als vielmehr gegen ihn. Ist es wirklich sinnvoll, dass Postdocs einiger Fächer geradezu gezwungen werden, die eigene Universität zu verlassen und ins Ausland zu gehen? Und was ist mit dem Hausberufungsverbot?

Die Nebenwirkungen auf den Nachwuchs werden kaum bedacht.
Sicherlich ist es wichtig, Professuren mit externen Bewerberinnen und Bewerbern von anderen Unis zu besetzen, um Seilschaften im eigenen Haus zu verhindern. Aber können Universitäten sich den Luxus leisten, in den eigenen Nachwuchs zu investieren mit der ausdrücklichen Absicht, diese Investition später nicht zu nutzen? Ganz unabhängig davon: Die Nebenwirkungen auf den Nachwuchs werden kaum bedacht.
Dieser Nachwuchs – es handelt sich immerhin um Menschen einer Altersgruppe bis Mitte 40 – muss für Lehre, Habilitationsschriften und Publikationen einen hohen Aufwand treiben, der kaum eine Balance mit der Freizeit zulässt; er muss sich fortlaufend auf Bewerbungen an anderen Universitäten einstellen, und dies mit eher ungewissen Erfolgsaussichten und hoher Planungsunsicherheit: Laut der Deutschen Gesellschaft Juniorprofessur wissen zwei Drittel aller Juniorprofessorinnen und -professoren auch eineinhalb Jahre vor Ablauf ihrer sechs Jahre nicht, wie es danach weitergeht. Ein Plan B ist daher unerlässlich; alternative Möglichkeiten für eine Karriere außerhalb der Uni müssen auch von den Vorgesetzten angesprochen werden.

Als erfolgreich anerkannt wird nur, wer auf eine Professur berufen wird.
Eine gewichtige Ursache für die insgesamt unbefriedigende Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses liegt sicherlich auch in dem unilinearen Karrierebegriff der deutschen Universität; als erfolgreich anerkannt wird nur, wer auf eine Professur berufen wird. Damit aber werden alle, die – aus guten Gründen – ins Wissenschaftsmanagement, in die Wirtschaft oder sonst wohin wechseln, automatisch zu Versagern erklärt.
Damit junge Akademikerinnen und Akademiker die Universität als attraktiven Arbeitsplatz erkennen und sich bewusst dafür entscheiden, muss sie konkurrenzfähiger werden. Die vielseitigen Angebote der institutionalisierten Nachwuchsförderung, etwa Mentoringprogramme, sind ein Schritt in diese Richtung.
Trotzdem wird den einzelnen Professorinnen und Professoren eine große Macht über Biografien und Schicksale auferlegt und abverlangt. Kaum ein Lehrstuhl verfügt über so etwas wie ein Qualitätsmanagement, und nicht alle Kolleginnen und Kollegen sehen ihre Funktion in Führung, Orientierung oder Personalentwicklung. Oft wissen sie auch nicht, wie sie all das umsetzen können.

Es wäre viel gewonnen, wenn Nachwuchsförderung nicht mehr nur als Förderung wissenschaftlicher Exzellenz verstanden würde.
Dass noch im November 2014 im RUB-Campusmagazin Rubens die Vorteile von Mitarbeitergesprächen regelrecht angepriesen werden mussten, macht doch eher skeptisch; schließlich sind solche Gespräche als ein Personalführungsinstrument in Wirtschaftsunternehmen seit Jahren gang und gäbe.
Es wäre viel gewonnen für das deutsche Hochschulsystem, wenn Nachwuchsförderung nicht mehr nur als Förderung wissenschaftlicher Exzellenz verstanden würde, sondern als Personalentwicklung und Karriereplanung in einem umfassenden Sinn. Dies kann nicht erfolgen durch zentrale Programme, sondern ist eine Aufgabe, die in den dezentralen Einheiten, in den Lehrstühlen angegangen werden muss.