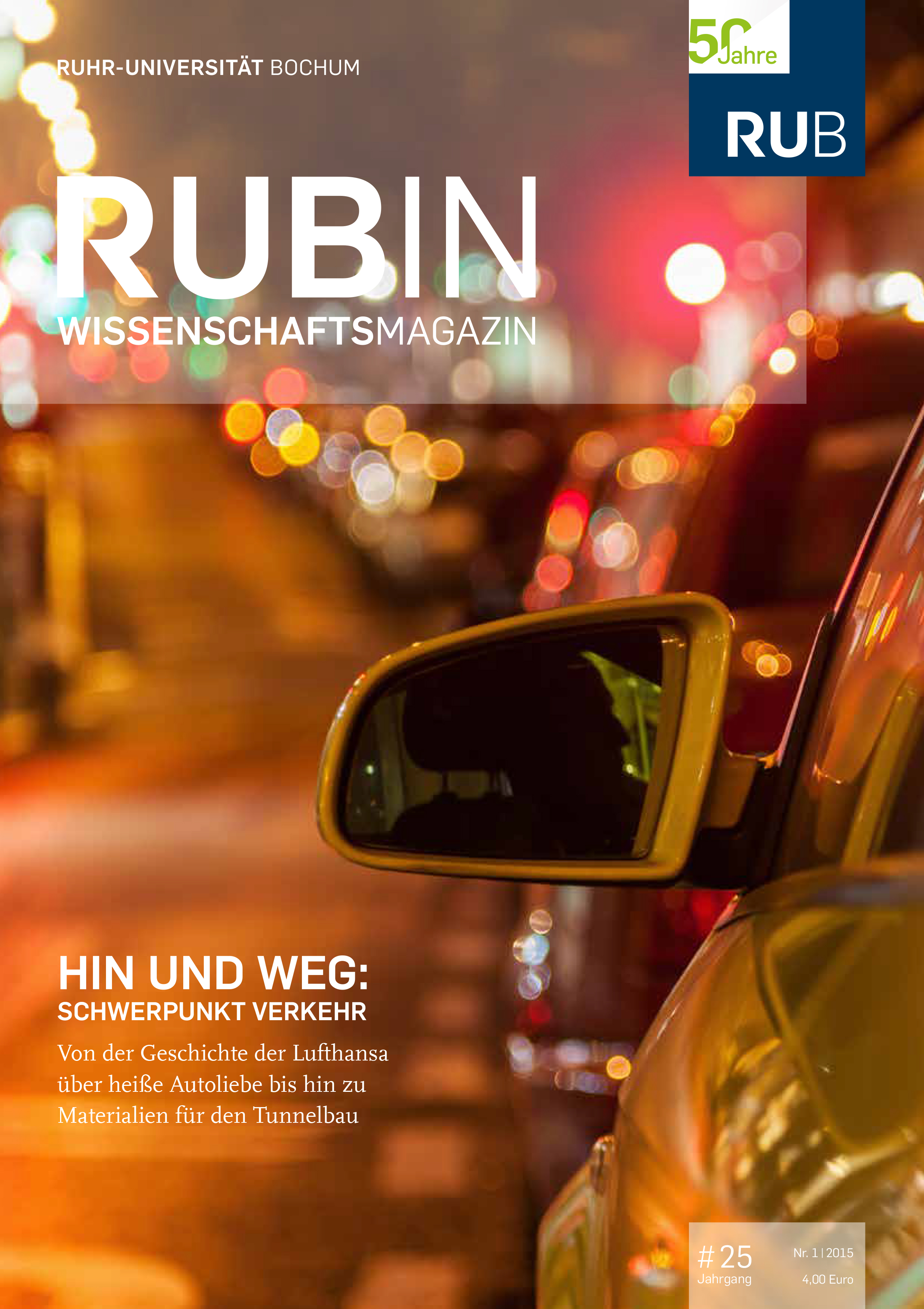Hochschulkarriere
Eine Sache des Vertrauens
Der Weg von der Doktorarbeit zur Professur ist kein leichter. Viele Nachwuchswissenschaftler konkurrieren um wenige Posten. Wie nehmen sie ihre Situation und die Karrierechancen wahr?
Ein exzellenter Masterabschluss, eine zügig absolvierte Doktorarbeit, ein Stipendium für einen Auslandsaufenthalt und schließlich auf der Professur gelandet – eine vorbildliche wissenschaftliche Karriere. Aber was muss man eigentlich tun, damit das klappt? Ist Erfolg eine Frage von Leistung oder von Glück? Wer in der Wissenschaft zu arbeiten beginnt, kann keineswegs sicher sein, das Karriereziel Professur zu erreichen.
„Man muss schon eine ganze Menge Vertrauen haben, um sich auf so eine riskante Geschichte einzulassen“, sagt Prof. Dr. Heiner Minssen vom Institut für Arbeitswissenschaft. Aber was ist eigentlich Vertrauen? Und was denkt der wissenschaftliche Nachwuchs über das System?
Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen Caroline Richter und Christina Reul nimmt Heiner Minssen die Karrierebedingungen im deutschen Hochschulsystem unter die Lupe und stellt die Frage, welche Rolle Vertrauen für den wissenschaftlichen Nachwuchs auf dem Weg zum angestrebten Berufsziel spielt.

Zu diesem Zweck führt das Team ausführliche Gespräche mit Unipräsidenten, Professoren, Mitarbeitern von Förder- und Forschungsinstitutionen sowie Postdoktoranden, also Wissenschaftlern, die ihre Promotion bereits abgeschlossen haben. 19 Interviews sind bereits gelaufen, ein paar mehr noch geplant, vor allem mit Professoren.
Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden über Empfehlungen, im Internet und teils an der eigenen Hochschule gefunden, bei allen stieß die Studie auf großes Interesse: „Wir haben aus dem Hochschulmanagement und von Professoren keine einzige Absage bekommen“, so Minssen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten aus drei Disziplinen mit unterschiedlichen Fachkulturen: Historiker, die zum Beispiel ihre Werke in der Regel allein und erst in hohem Alter veröffentlichen; Physiker, die oft in Teams arbeiten und auf Instrumente angewiesen sind; und Betriebswirte, denen hohe Chancen auf dem externen Arbeitsmarkt zugeschrieben werden. Letztere waren für Minssen und sein Team auch deshalb interessant, weil sie erwarteten, dass Betriebswirte leicht von der freien Wirtschaft in das Unisystem zurückkehren können.

Diejenigen, die das System verlassen, haben kaum Chancen zurückzukommen.
Christine Richter
„Aber auch bei den Betriebswirten haben wir festgestellt, dass diejenigen, die das System verlassen, kaum Chancen haben zurückzukommen“, erzählt Caroline Richter. „Wir spitzen das als Zeichen für das Reinheitsgebot der Wissenschaft zu. Im Großen und Ganzen haben uns Personen aus allen Disziplinen und Statusstufen die gleichen Geschichten erzählt.“
Prekäre Situation
Häufig wird die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses – das sind alle, die noch keine Professur innehaben – mit dem Stichwort prekär belegt. Laut Heiner Minssen ist die Situation objektiv betrachtet auch so: standardmäßig befristete Arbeitsverträge, oft nur über kurze Zeit, oder der Nachwuchs muss direkt selbst zusehen, wie er an Gelder kommt.
Trotzdem zeigen die Interviews, dass die Nachwuchsforscherinnen und -forscher ihre Lage nicht zwingend als prekär und belastend empfinden. „Nicht wenige halten die Bedingungen für selbstverständlich und arbeiten mehr oder minder in der blinden Hoffnung, dass sich später schon alles zum Guten auflösen wird“, resümiert Prof. Minssen.
Dieses Vertrauen auf einen guten Ausgang sieht er mit als Grund dafür, dass sich der wissenschaftliche Nachwuchs in der Regel aus Nicht-Arbeiterschichten rekrutiert. „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das nicht nur daran liegt, dass die Personen eine bessere Förderung in der Schule bekommen, sondern auch daran, dass sie aufgrund ihrer Lebensumstände gelernt haben: Es wird schon alles klappen.“

Wie wichtig Doktorvater oder Doktormutter sind, das wird häufig von den Kollegen unterschätzt.
Heiner Minssen
Neben der Zuversicht auf ein gutes Ende und eine Karriere in der Wissenschaft sind auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder das Vertrauen zum Vorgesetzten entscheidend. In den bisherigen Gesprächen kristallisierte sich klar heraus, dass Doktorvater oder Doktormutter eine bedeutende Rolle dabei spielen, welchen Weg ihre Zöglinge später einschlagen. Persönliches Feedback, etwa Bestätigung durch den Promotionsbetreuer oder die -betreuerin, oder ermutigende Rückmeldungen durch Kollegen auf Konferenzen stiften Zuversicht. Und zwar deutlich mehr als Auszeichnungen wie Stipendien oder Preise.
„Wie wichtig der persönliche Kontakt ist, wie wichtig Doktorvater oder Doktormutter sind, das wird häufig von den Kollegen unterschätzt“, sagt Heiner Minssen und unterstreicht, dass es auch auf die Art und Weise ankommt, wie Feedback vorgetragen wird. „Wenn ein Amerikaner sich auf einer Konferenz zu Wort meldet, bedankt er sich erst einmal für den Vortrag, der hochinteressant gewesen sei, und trägt dann noch ein paar kritische Anmerkungen vor. In Deutschland fängt man direkt mit der Kritik an.“ Dass das aber kränkend sein kann für die, die sich mit ihrem Thema identifizieren, sei vielen nicht bewusst.
Zur Forschung berufen
Das Thema ist für den Soziologen ein zentraler Punkt. Wissenschaftler fühlen sich in der Regel zur Forschung berufen und brennen dafür, ein bestimmtes Problem zu lösen oder die Antwort auf eine spezielle Frage zu finden. Anders als in Unternehmen spielt die strategische Karriereplanung an den Hochschulen daher kaum eine Rolle. Mit anderen Worten: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen sich nicht ein Thema aus, von dem sie sich die besten Aufstiegschancen erhoffen, sondern widmen sich der Frage, die sie am meisten interessiert und am meisten motiviert.

Strategisches Handeln hat in der Wissenschaft tatsächlich ein bisschen den Ruf von igittigitt.
Heiner Minssen
Fragten Minssen und sein Team, ob ihre Interviewpartner eine besondere Strategie für ihren Berufsweg verfolgten, lehnten diese bisher mehr oder weniger vehement ab. „Strategisches Handeln hat in der Wissenschaft tatsächlich ein bisschen den Ruf von igittigitt“, veranschaulicht Heiner Minssen. „Man steht als Person für ein Thema oder für eine Idee.“
Selbst wer eine klare Strategie verfolgen wollte, würde nach den ersten Ergebnissen der Studie schnell auf Probleme stoßen. Viele sprechen von der Elite im Hochschulsystem, aber kaum einer weiß, welche Kriterien eigentlich an die Besten angelegt werden. Was muss man tun, um es in der Wissenschaft weit zu bringen? Publizieren, international sichtbar sein, Lehrerfahrung sammeln und Drittmittel einwerben lauten die typischen Antworten. Der Nachwuchs weiß über die zu erfüllenden Anforderungen Bescheid, aber das Entscheidende ist nicht transparent: das implizite Wissen über meist ungeahnte Spielregeln der Universitätskarriere.

„Neben den transparenten Kriterien gibt es eine Schattenwelt, über die nicht gesprochen wird“, stellt Richter fest. Nicht objektive und nicht quantifizierbare Kriterien sind gemeint: „Dann geht es etwa darum, inwieweit jemand seinen Chef imitiert, dieser sich dadurch wertgeschätzt fühlt und bereit ist, mehr in seinen Zögling zu investieren.
Karriere nicht planbar
Auch vermeintlich quantifizierbare Kriterien entpuppen sich häufig nicht als klare Marksteine für die Karriere. Veröffentlichungen sind zwar entscheidend. „Aber man weiß auch nicht so genau, wie man in die Zeitschriften hineinkommt, die so unglaublich wichtig sind“, erklärt Caroline Richter. „Und wie viele Veröffentlichungen muss man denn nun haben? Sieben? Oder 25? Reicht letztlich die Juniorprofessur oder muss es doch unbedingt die Habiltation sein?“
Ausrechnen lässt sich die Karriere nicht. Hier sieht das Team vom Institut für Arbeitswissenschaft einen klaren Unterschied zur Industrie, wo es Personalplanung gibt und Management gelernt wird. Richter: „Die Unis bilden ihren Nachwuchs aus, der später in höchste Positionen berufen werden soll, ohne dass den Nachwuchsforschern überhaupt bewusst ist, was sie für die höchste Position tun müssen.“
Erfolg durch Glück oder Leistung?
Ist Erfolg im Hochschulsystem also eine Frage des Glücks oder der Leistung? Die Antworten darauf fielen bislang sehr unterschiedlich aus. Je höher die Interviewten in der Hierarchie bereits gekommen sind, desto mehr berufen sie sich darauf, dass Erfolg eine Frage der Leistung sei. Der Nachwuchs hingegen gibt an, dass Erfolg mehr mit Glück zu tun habe.
Zwischen Faktenwissen und Ungewissheit bleibt so eine Lücke, die sich zwar durch Vertrauen schließen lässt; sie sensibilisiert aber nicht dafür, dass ein Plan B notwendig sein könnte. Gute Ansätze für eine bessere Planbarkeit der beruflichen Laufbahn sehen Minssen und sein Team in Mentoringprogrammen und Graduiertenschulen – auch wenn der Kontakt mit Gleichgesinnten ebenfalls dazu führen kann, dass man die eigene Situation mehr hinterfragt und ein Stück des blinden Vertrauens aufgibt.
Die meisten Nachwuchsförderprogramme existieren für die Postdoc-Phase, die sich in der Studie bereits als entscheidend über den späteren Berufsweg herausstellte. Um dieser Spur nachzugehen, wurden zusätzlich Fokusgruppen mit jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sowie teilnehmende Beobachtungen in der Nachwuchsförderung durchgeführt.
„Es ist die vertrauensschwierigste Situation“, sagt Minssen. „Die Verhandlungspartner ändern sich, das Berechenbare verschwindet, man muss neue Leute von sich überzeugen.“ Es kommt zum „Vater- oder Muttermord“, die Beziehung zwischen Betreuer und Doktorand ändert sich, nicht selten entsteht auch Konkurrenz.
Warum fähige Forscher die Wissenschaft verlassen
Hinzu kommt in manchen Disziplinen, etwa in der Physik, dass das System quasi verlangt, nach der Promotion ins Ausland zu gehen. Für viele ist das vielleicht nicht mit der erwünschten Work-Life-Balance zu vereinbaren. Minssen überlegt: „Ist es eine sinnvolle Strategie, die Leute zu zwingen, ins Ausland zu gehen – und wenn man das nicht will, raus aus der Wissenschaft? Ich sehe ein großes Problem darin, dass sehr fähige Menschen das Wissenschaftssystem verlassen, weil sie sich den Bedingungen nicht aussetzen wollen.“ Vielleicht auch, weil sie nicht genug Vertrauen haben, dass schon alles gut werden wird? Nicht jedem ist diese Einstellung in die Wiege gelegt.
Vertrauen ist entscheidend für eine Karriere im deutschen Hochschulsystem, schlussfolgert die Studie von Heiner Minssen, Caroline Richter und Christina Reul. Interessanterweise ergibt sie aber auch, dass bisher kaum einer der Interviewten in Worte fassen konnte, was Vertrauen für sie eigentlich bedeutet.