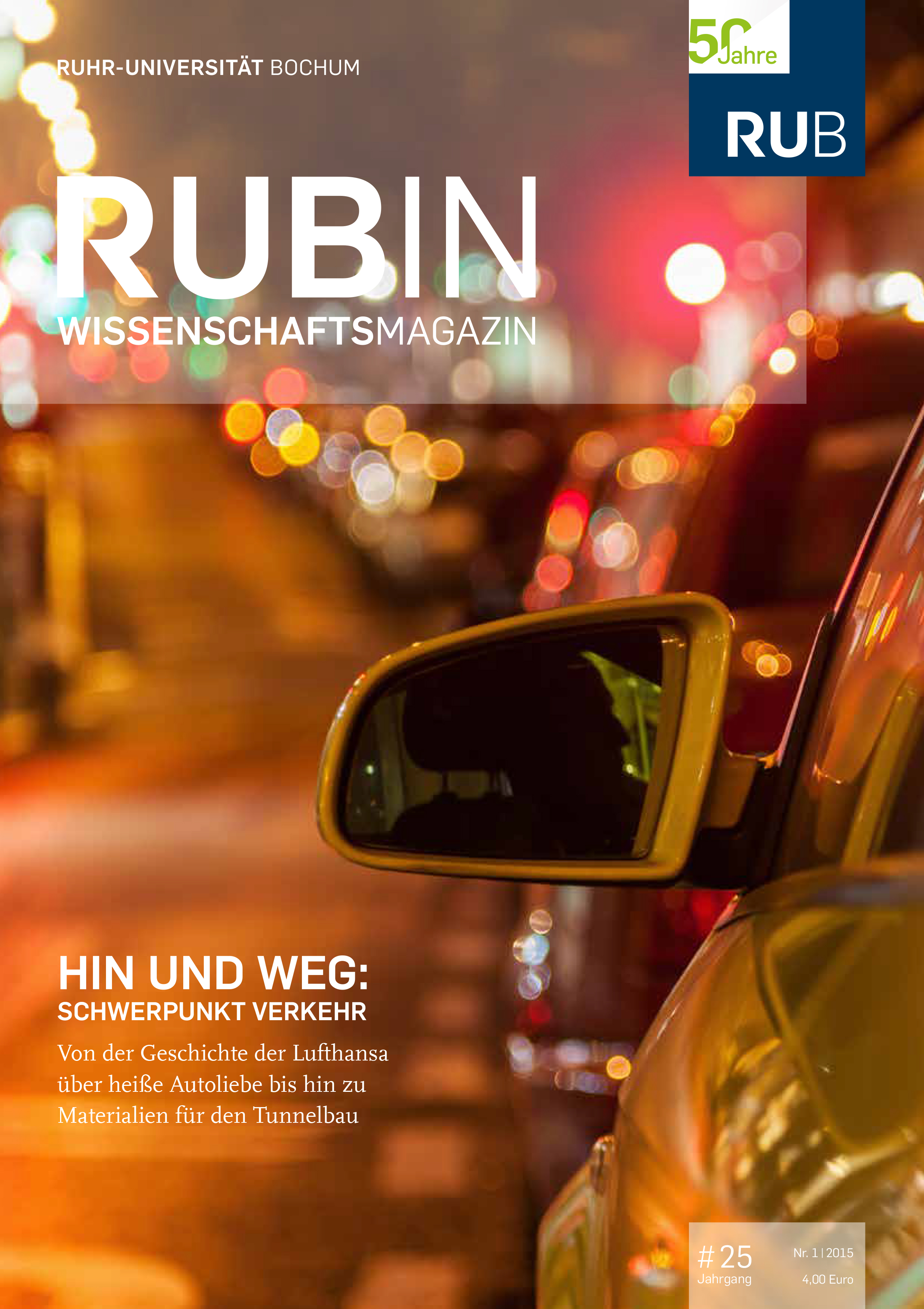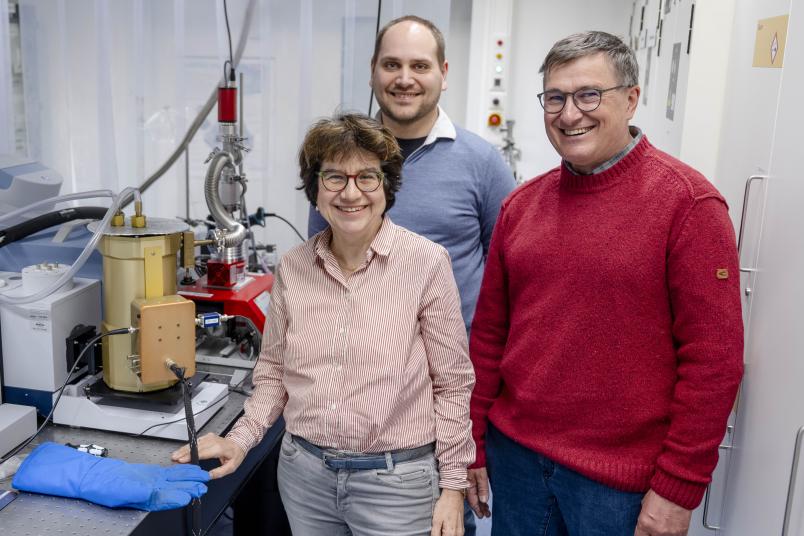Stau in Deutschland
Die Zuverlässigkeit von Autobahnen berechnen
Manche Autobahnstrecken sind als zeitlich unberechenbar bekannt. Diese Unzuverlässigkeit soll im kommenden Bundesverkehrswegeplan in die Bewertung der Investitionsmaßnahmen einfließen.
Autofahrer kennen das leidige Problem: Gestern noch sind sie ohne Schwierigkeiten über die Autobahn zur Arbeit gekommen, heute stehen sie im Stau. Gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es notorisch überlastete Strecken, bei denen man sich nicht darauf verlassen kann, pünktlich ans Ziel zu kommen. Würde es nicht helfen, an diesen Engpässen mehr Fahrstreifen anzulegen oder gleich eine neue Autobahn zu bauen?
Mehr Platz wäre eine Lösung
Mehr Platz für all die Autos wäre eine Lösung; aber das Geld dafür ist nicht im Überfluss vorhanden, und natürlich können Straßen auch nicht allerorts beliebig breit angelegt werden. Der Bund entscheidet, welche Maßnahmen im Fernstraßennetz am dringendsten sind und zuerst umgesetzt werden. Um den sogenannten Bundesverkehrswegeplan zu erstellen, wird ein kompliziertes Modell genutzt. Es hilft zu ermitteln, welche Maßnahmen volkswirtschaftlich am sinnvollsten sind. Einen Teil des Modells für den Bundesverkehrswegeplan 2015 hat das RUB-Team um Prof. Dr. Justin Geistefeldt erstellt.
Für die Analyse wird Deutschland in Verkehrszellen eingeteilt. Dann wird ermittelt, wie viele Fahrten zwischen welchen Zellen stattfinden und welche Routen die Fahrerinnen und Fahrer nehmen. Um Investitionsmaßnahmen im Straßenbau zu bewerten, wird im Modell berechnet, wie sich die mittlere Fahrtzeit auf einer bestimmten Route durch einen Aus- oder Neubau ändern würde.

Nur die mittleren Fahrtzeiten zu berücksichtigen ist problematisch.
Justin Geistefeldt
Eine Baumaßnahme wird tendenziell besser bewertet, wenn sie dafür sorgt, dass die Verkehrsteilnehmer schneller ans Ziel kommen. In die Bewertung fließen aber auch andere Parameter ein: Kosten, Umweltbelastung, Einfluss auf das Unfallgeschehen sowie auf angrenzende Siedlungen und Naturräume. „Nur die mittleren Fahrtzeiten zu berücksichtigen ist jedoch problematisch“, sagt Justin Geistefeldt, Leiter des Lehrstuhls für Verkehrswesen – Planung und Management. Wichtig sei es auch, die Zuverlässigkeit der Fahrtzeit in das Modell einzubeziehen. Genau dafür haben die Bochumer eine Funktion entwickelt.
„Wenn man mit der mittleren Fahrtzeit rechnet, werden nur Zeitverluste durch die tatsächlich eintretenden Staus berücksichtigt“, erklärt der RUB-Ingenieur. Aber es gibt noch ein anderes Phänomen, das den Reisenden Zeit kosten kann, nämlich die Unberechenbarkeit des Verkehrszustandes.
Zeit verlieren, obwohl kein Stau ist
Geistefeldt gibt ein Beispiel: „Nehmen wir an, Sie müssen pünktlich um 16.30 Uhr bei einem Termin in Duisburg sein. Aus Bochum brauchen Sie über die Autobahn A 40 im Mittel 40 Minuten. Wahrscheinlich fahren Sie aber nicht erst um 15.50 Uhr los, weil Sie wissen, dass auf der A 40 häufig Stau ist. Also starten Sie um 15.30 Uhr. Wenn der Termin ganz wichtig ist, vielleicht sogar um 15 Uhr.“
Möglicherweise ist gerade an diesem Tag aber gar kein Stau auf der Strecke und man kommt viel zu früh an. „Dann sind Sie um 15.40 Uhr in Duisburg, fast eine Stunde zu früh, und können die Zeit möglicherweise gar nicht nutzen“, ergänzt Geistefeldt. „Sie verlieren also Zeit, obwohl es gar keinen Stau gab.“ Diese Zeitverluste entstehen aufgrund der Variabilität der Fahrtzeit von Tag zu Tag; mathematisch lässt sich diese Variabilität durch die Standardabweichung beschreiben. In den Bundesverkehrswegeplan 2015 geht sie als Bewertungskenngröße mit ein.
Ein kleiner Teil in einem komplexen Modell
Um zu ermitteln, wie sich die Zuverlässigkeit einer Strecke durch einen Ausbau ändert, muss man die Standardabweichung mit anderen Parametern der Verkehrsinfrastruktur in Zusammenhang setzen, zum Beispiel Anzahl der Fahrstreifen, Steigung, Schwerverkehrsanteil und Lage der Strecke. Der sogenannte Auslastungsgrad umfasst all diese Parameter. Er ist definiert als das Verhältnis der Verkehrsnachfrage zur Kapazität einer Strecke, und die Kapazität wiederum ist abhängig von den oben genannten Größen.
„Für den Zusammenhang zwischen der Standardabweichung der Fahrtzeit und dem Auslastungsgrad ergibt sich eine gar nicht so komplizierte Funktion“, sagt Justin Geistefeldt. Tatsächlich könnte man die Zuverlässigkeit noch genauer wiedergeben als mit der Standardabweichung. Aber dann würde das Modell zu komplex werden. Schließlich ist die Bochumer Funktion nur Teil eines größeren Modells, das potenzielle Baumaßnahmen volkswirtschaftlich bewertet. Und das für Milliarden von Fahrten zwischen den einzelnen Verkehrszellen. Bis ein Ergebnis vorliegt, rechnen die Computer mehrere Tage.
Die Zuverlässigkeit in die Bewertung potenzieller Investitionsmaßnahmen im Fernstraßennetz einzubeziehen, ist für Justin Geistefeldt ein wichtiger Schritt. Denn dadurch werden Ausbaumaßnahmen an hoch belasteten Engpässen tendenziell höher gewichtet als Neubaumaßnahmen. Ein Beispiel: Wenn in einem ländlichen Gebiet eine neue Autobahn als Alternative zu einer bereits existierenden Bundesstraße entsteht, verringert sich zwar die mittlere Fahrtzeit auf dieser Route. Die Zuverlässigkeit der Fahrtzeit ändert sich aber kaum, sofern die Bundesstraße nicht überlastet ist.
Ganz anders ist die Lage auf Strecken, wo die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer regelmäßig im Stau stehen und früher losfahren müssen, weil sie sich nicht darauf verlassen können, rechtzeitig anzukommen. Die Entschärfung solcher Engpässe sollte laut Geistefeldt Priorität vor Neubauprojekten in ländlichen Regionen haben. Die verbesserte Rechenmethode für den Bundesverkehrswegeplan 2015 leistet dazu einen Beitrag.