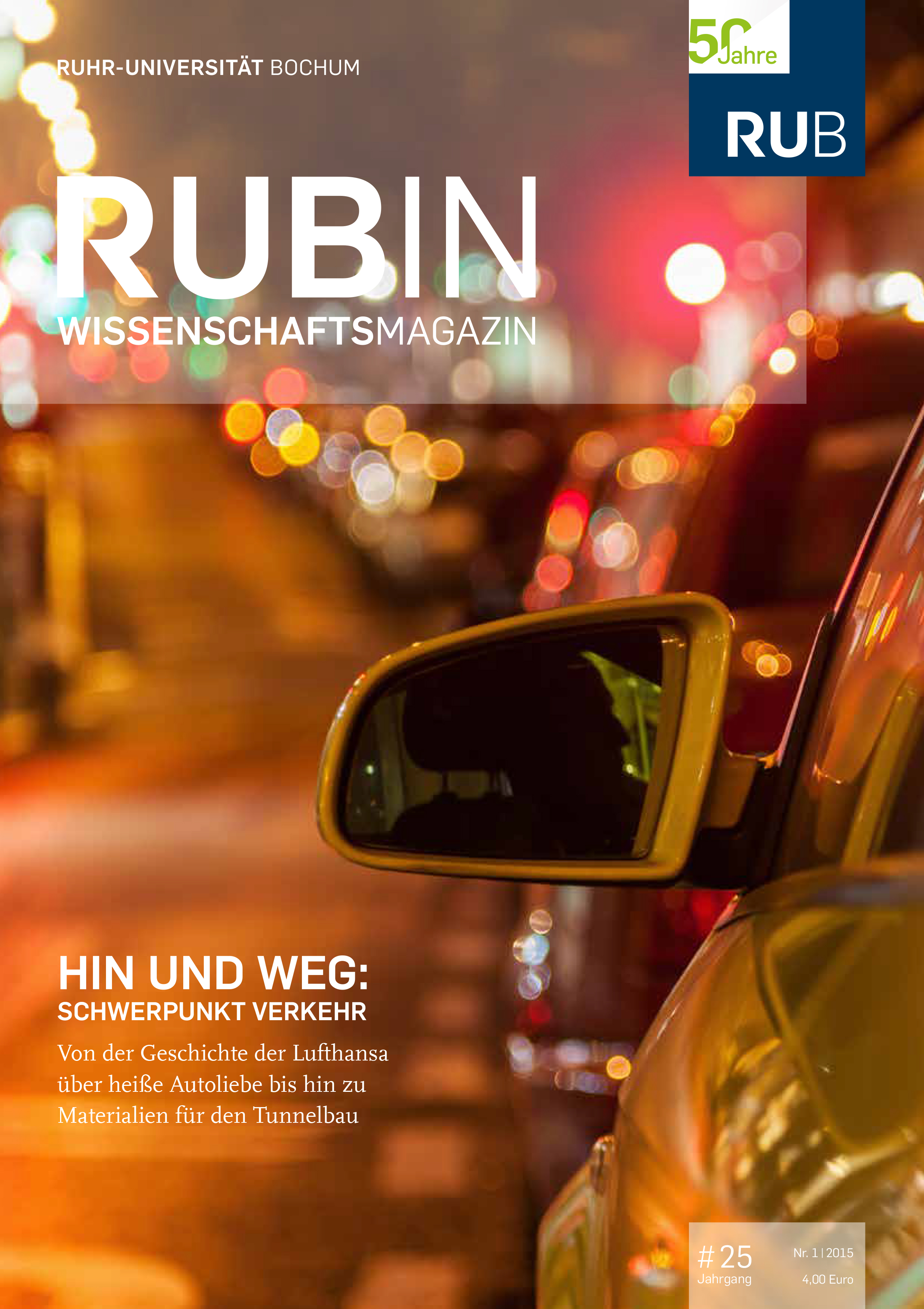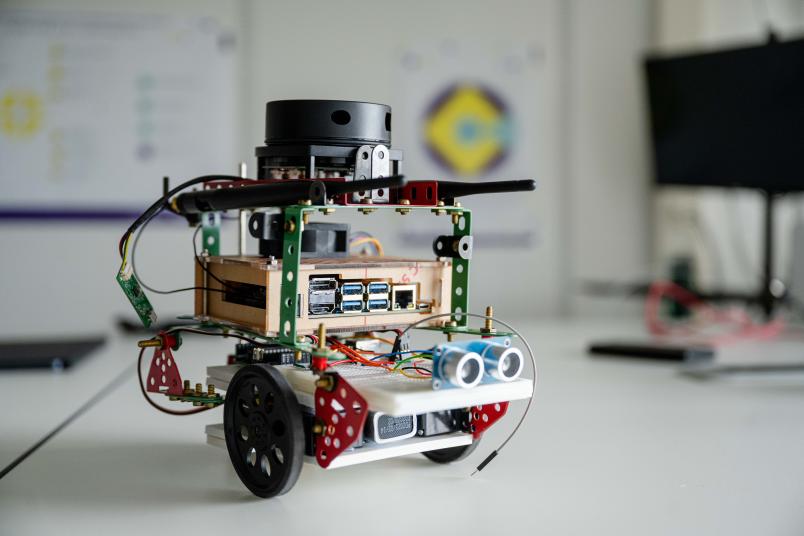Interview
„Viele Staus sind vermeidbar“
Nordrhein-Westfalen ist Deutschlands Stauland Nummer eins. Das müsste nicht so sein, erzählt Justin Geistefeldt im Rubin-Interview.
Prof. Geistefeldt, Sie haben den Lehrstuhl für Verkehrswesen inne und haben für den Bundesverkehrswegeplan 2015 ein Modell zur Ermittlung der Zuverlässigkeit der deutschen Autobahnen entwickelt. Was versteht man darunter?
Ein zuverlässiger Verkehrsablauf bedeutet, dass die Fahrtzeit auf einer Route von Tag zu Tag annähernd gleich ist. Unerwartete Störungen führen hingegen dazu, dass die Verkehrsteilnehmer zusätzliche Zeitpuffer einplanen müssen, wenn sie ihr Fahrtziel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit pünktlich erreichen wollen. Die Zuverlässigkeit sollte man berücksichtigen, wenn man den Ausbau oder Neubau von Strecken bewertet.
Die A 40 im Ruhrgebiet – eine der staureichsten Autobahnen Deutschlands – wird derzeit zwischen Bochum und Essen von vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Kann man die Staus so in den Griff bekommen?
Durch den sechsstreifigen Ausbau wird es deutlich weniger Staus geben. Allerdings wird sich ein Teil der Staus an andere Engpässe, beispielsweise am Dreieck Essen-Ost, verlagern. Außerdem kann sich durch den Ausbau auch die Verkehrsnachfrage verändern. Viele Verkehrsteilnehmer stellen sich zurzeit auf den Stau ein, nutzen andere Verkehrsmittel, weichen auf alternative Routen aus oder fahren früher oder später als zu den Stoßzeiten. Wenn der Ausbau beendet ist, werden möglicherweise wieder mehr Leute zu den üblichen Zeiten auf der A 40 fahren. Somit ist nicht zu erwarten, dass es überhaupt keine Staus mehr gibt. Darauf ist der Ausbau auch nicht angelegt.
Was ist denn das Ziel, wenn man einen solchen Ausbau plant?
Die Verkehrsqualität wird mit einem Schulnotensystem bewertet. Da das Bewertungskonzept aus den USA stammt, mit den Noten A bis F; A ist die beste. Wenn eine neue Verkehrsanlage geplant wird, hat man aber nicht das Ziel, Stufe A zu erreichen. Es wäre unwirtschaftlich, alle Straßen so breit zu bauen, dass eine sehr gute Verkehrsqualität erreicht wird. Die Zielgröße ist in der Regel die Qualitätsstufe D. Das ist wie bei einer Klausur: Viele Studierende wollen einfach nur mit „ausreichend“ bestehen. Der Straßenbaulastträger kann auch festlegen, dass er Stufe C oder nur E erreichen will. Aber in der Regel ist es D.
Das klingt nicht besonders ambitioniert.
Man muss berücksichtigen, wie die Qualitätsstufen definiert werden. Sie gelten für eine maßgebende Bemessungsstunde, die sogenannte 30. Stunde. Ein Jahr hat 8760 Stunden. Diese sortiert man nach der Höhe der Verkehrsbelastung, wobei auf Platz eins die Stunde mit der höchsten Belastung steht. Die Verkehrsbelastung aus der Stunde an Position 30 liegt der Bewertung der Verkehrsqualität zugrunde. Das heißt aber nicht, dass die Verkehrsqualität im Jahresdurchschnitt nur die Note D erreicht.
Was kann man neben dem Ausbau noch tun, um eine Strecke zuverlässiger zu machen?
Unfallstellen schnell räumen, ein gutes Baustellenmanagement und eine effektive Verkehrssteuerung. Die Verkehrsnachfrage ist nur bedingt beeinflussbar, aber man kann versuchen, den Verkehr so zu homogenisieren, dass kein Zusammenbruch entsteht.
Zusammenbruch heißt Stau.
So ist es. Ob ein Stau entsteht oder nicht, hängt unter anderem stark davon ab, welches Fahrerkollektiv gerade auf einer Strecke unterwegs ist. Es kann zum Beispiel sein, dass auf derselben Strecke an einem Tag mit 3900 Fahrzeugen pro Stunde ein Stau entsteht, an einem anderen Tag mit 4100 Fahrzeugen pro Stunde aber nicht.
Je dichter der Verkehr wird, desto mehr Fahrzeuge fahren in Kolonnen. Wenn in einer Kolonne das erste Fahrzeug bremst, bremst auch der nachfolgende Fahrer – aber erst nach einer gewissen Reaktionszeit. Um sie wettzumachen, muss er etwas stärker bremsen, der dritte noch etwas stärker und so weiter. Irgendwann kommt ein Fahrzeug völlig zum Stillstand. Es entsteht ein „Stau aus dem Nichts“. Der Verkehr bricht zusammen.
Gibt es Fahrerkollektive, die besonders stauarm fahren?
Ortskundige Pendler verhalten sich effizienter als beispielsweise Urlauber. Viele Autobahnen in Ballungsräumen haben daher – bei gleichem Ausbauzustand – eine höhere Kapazität als Strecken in Urlaubsregionen. Pendler wissen, dass es auf kurzen Strecken nichts bringt, direkt immer auf den linken Fahrstreifen zu wechseln.
Gegebenenfalls fahren sie nur bis zur nächsten oder übernächsten Anschlussstelle auf der Autobahn und bleiben einfach auf dem rechten Fahrstreifen. Dadurch entsteht ein systematisch effizienterer Verkehrsablauf als zum Beispiel auf Fernverkehrs- oder Urlaubsrouten, wo die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Fahrstreifen höher sind und sich der Verkehr ungleichmäßiger auf die Fahrstreifen verteilt.
Dann muss der Verkehr homogenisiert werden.
Genau, zum Beispiel mit Streckenbeeinflussungsanlagen, also den Leuchtzeichen, die Warnungen vor Gefahrenstellen anzeigen oder bei hoher Verkehrsdichte ein Tempolimit. Das macht man, um die Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen den Fahrstreifen gering zu halten, damit niemand zu stark bremsen muss und einen Stau verursacht. Auch die Zuflussregelung an Autobahneinfahrten hilft. Die Lichtsignalanlagen, an denen nur ein Fahrzeug bei Grün fahren darf, sorgen dafür, dass Fahrzeuge nicht in Pulks einfahren. Ein bis zwei Fahrzeuge können sich bei viel Verkehr vielleicht noch so einfädeln, dass der Verkehr weiterläuft. Wenn mehrere Autos in dichtem Abstand einfahren, kann das einen Stau auslösen.
Diese Maßnahmen gibt es in NRW ja schon. Und trotzdem gibt es in dem Bundesland mehr Staus als in jedem anderen. Was kann noch getan werden?
Das Baustellenmanagement hat aus meiner Sicht noch Verbesserungspotenzial. Bei der Baustellenplanung muss immer ein Kompromiss zwischen der optimalen Lösung für den Bauablauf und der optimalen Lösung für den Verkehrsablauf gefunden werden. Momentan wird noch zu häufig zulasten des Verkehrs entschieden.