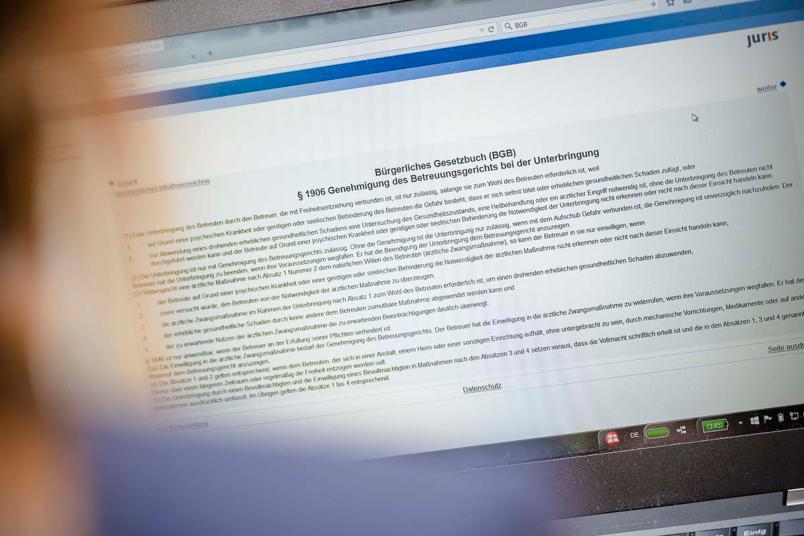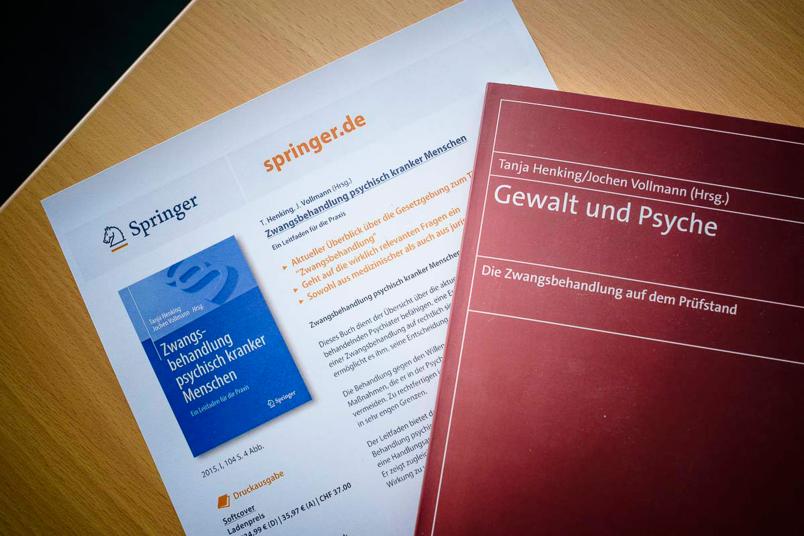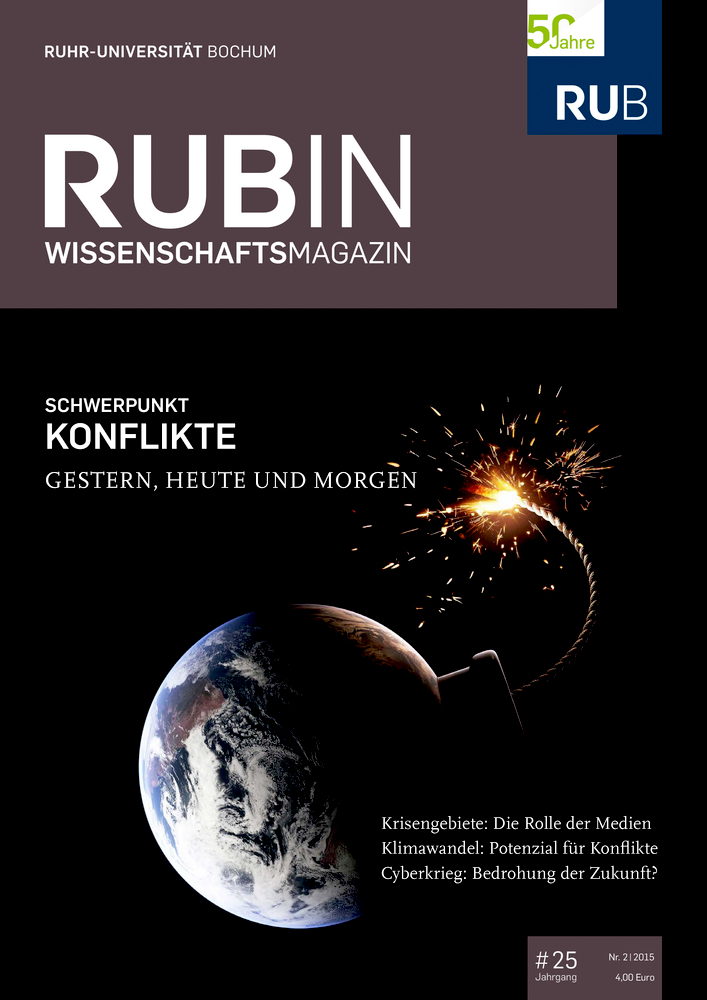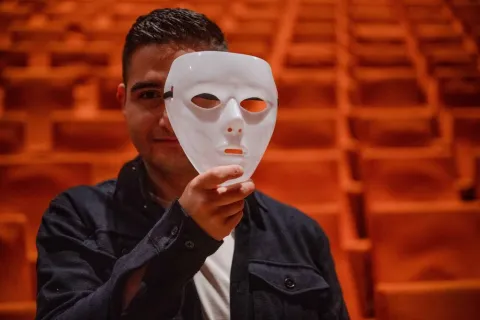Zwangsbehandlungen in Psychiatrien
Das Recht, Nein zu sagen
In deutschen Psychiatrien wurden Patienten jahrzehntelang unkritisch gegen ihren Willen medikamentös behandelt, wenn die Ärzte es für notwendig hielten. So sollte das nicht sein, mein Tanja Henking.
Wohl niemandem behagt die Vorstellung, er oder sie könne einmal in die Situation kommen, gegen den eigenen Willen und unter Zwang starke Medikamente wie Beruhigungsmittel verabreicht zu bekommen. In stationären Psychiatrien ist solch eine Zwangsbehandlung zwar nicht an der Tagesordnung, aber auch nicht ungewöhnlich.
Als Zwangsbehandlung gelten diagnostische oder therapeutische Maßnahmen, die ein Arzt gegen den Willen des Patienten durchführt. Die Zwangsbehandlung bei psychischen Erkrankungen erfolgt, um den Betroffenen vor schweren Schäden zu bewahren oder auch zum Schutz der Gemeinschaft.
Wie oft es zu solchen Behandlungen in Deutschland kommt, weiß man nicht. Geschätzt wird die Zahl auf 26.000 bis 90.000 Patientinnen und Patienten jährlich. Statistiken werden bislang nicht geführt.
Zwangsbehandlung verfassungswidrig
Die Zwangsbehandlung wurde jahrzehntelang nicht von offizieller Seite in Frage gestellt. Die Lobby der psychisch Kranken ist gering, sie haben es schwer, von Medien und Politikern ausreichend wahrgenommen zu werden.
Erst nachdem einzelne Patienten bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen waren, um gegen ihre Zwangsbehandlung zu klagen, entschieden die Richter 2011 und 2013, dass es keine gesetzliche Grundlage für dieses Vorgehen gebe. Sie erklärten die bisherigen landesrechtlichen Regelungen für verfassungswidrig und nichtig und stellten fest, dass jede Behandlung gegen den Willen einer Person einen tiefen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht darstellt.
Eine Behandlung gegen den Willen sei zwar nicht per se unzulässig, aber an die Rechtfertigung eines solchen Handelns seien strenge Maßstäbe zu legen und diese müssten klar gesetzlich geregelt sein. In der Folge gelangte der Bundesgerichtshof zum Schluss, dass auch die bundesrechtliche Regelung zur Zwangsbehandlung verfassungswidrig sei. Bundesgesetzgeber und Länder waren damit vor die schwierige Aufgabe gestellt, wie eine neue Regelung aussehen könnte.
Höhere Hürden für Zwangsbehandlung
Was das für die betroffenen Patienten bedeutet, weiß Juristin Dr. Tanja Henking. Die RUB-Wissenschaftlerin hat ihr Büro im Malakowturm und gehört dem Institut für Medizinische Ethik und Geschichte der Medizin an. Als Expertin für Medizinrecht leitet sie die Nachwuchsforschergruppe „Ethik und Recht in der modernen Medizin".
Sie begleitet die juristische Entwicklung in Sachen Zwangsbehandlung wissenschaftlich und legt dabei einen starken Fokus auf die Praxis. „Auch mit dem neuen Gesetz ist es einem Arzt oder einer Ärztin nicht per se verboten, einem psychotischen Patienten gegen seinen Willen starke Medikamente zu verabreichen. Doch die Hürden dafür sind hoch.

Wir müssen uns fragen, was ein guter Umgang mit diesen Patienten ist und wie viel er uns wert ist.
Tanja Henking
Anders als früher braucht es nun vorher eine richterliche Genehmigung. Um die zu bekommen, muss der Arzt nachweisen, dass die Behandlung verhältnismäßig und alternativlos ist“, so Henking. Bedeutet: Der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangsbehandlung muss die mögliche Beeinträchtigung, die der Patient durch sie erfährt, deutlich überwiegen.
Tanja Henking begrüßt diese Novellierung. Vor allem plädiert sie dafür, das neue Gesetz als Chance zu sehen, das bisherige Vorgehen in Psychiatrien zu reflektieren und daraus Schlüsse für einen würdigeren Umgang mit psychisch Kranken zu ziehen.
Denn eine Behandlung unter Zwang und gegen den eigenen Willen kann traumatische Folgen für den Patienten oder die Patientin haben. „Psychiater und Pflegepersonal, aber auch wir als Gesellschaft müssen uns fragen, was ein guter Umgang mit diesen Patienten ist und wie viel er uns wert ist.“
Alternativen zu Psychopharmaka
Dazu gehört Henkings Meinung nach vor allem, stärker über Alternativen zum Einsatz von Psychopharmaka nachzudenken. „Auch in Phasen großer Erregung oder Aggressivität sollten die Ärzte dem Patienten immer wieder das Gespräch als Deeskalationsmaßnahme anbieten“, sagt die Juristin. „Natürlich kann der Arzt oder die Ärztin der Meinung sein, ein bestimmtes Medikament wäre jetzt das Beste für den Patienten. Die Gründe dafür sollten diesem aber erklärt werden.“

Es kommt darauf an, den richtigen Zugang zum Patienten zu bekommen.
Tanja Henking
Doch kann man überhaupt davon ausgehen, dass ein stark verwirrter Mensch die Tragweite seiner Handlung realisieren kann? „Natürlich ist das eine Art Dilemma. Manchmal ist es ja Teil der Krankheit, dass der Patient überall Bedrohungen und Feinde vermutet – eben auch in Gestalt des Arztes oder der Ärztin. Das Argument der Einwilligungsunfähigkeit zählt aber für mich nicht“, so Henking.
„Wir können ja auch einem fünfjährigen Kind erklären, warum es beim Kinderarzt eine Spritze bekommt. Niemand würde heutzutage auf die Idee kommen, dem Kind einfach den Arm festzuhalten und ohne Vorwarnung oder Erklärung zu spritzen. Es kommt darauf an, den richtigen Zugang zum Patienten zu bekommen“, so die Forscherin.
Wie lange es dauern wird, bis ein Umdenken in deutschen Psychiatrien stattgefunden hat, ist ungewiss. Hier hat sich in den vergangenen wenigen Jahren viel getan, aber es liegt noch ein weiter Weg vor allen Beteiligten. Obwohl die ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes bereits im Jahr 2011 erfolgten, hat bis jetzt noch nicht einmal die Hälfte der Bundesländer ein neues Gesetz erlassen.