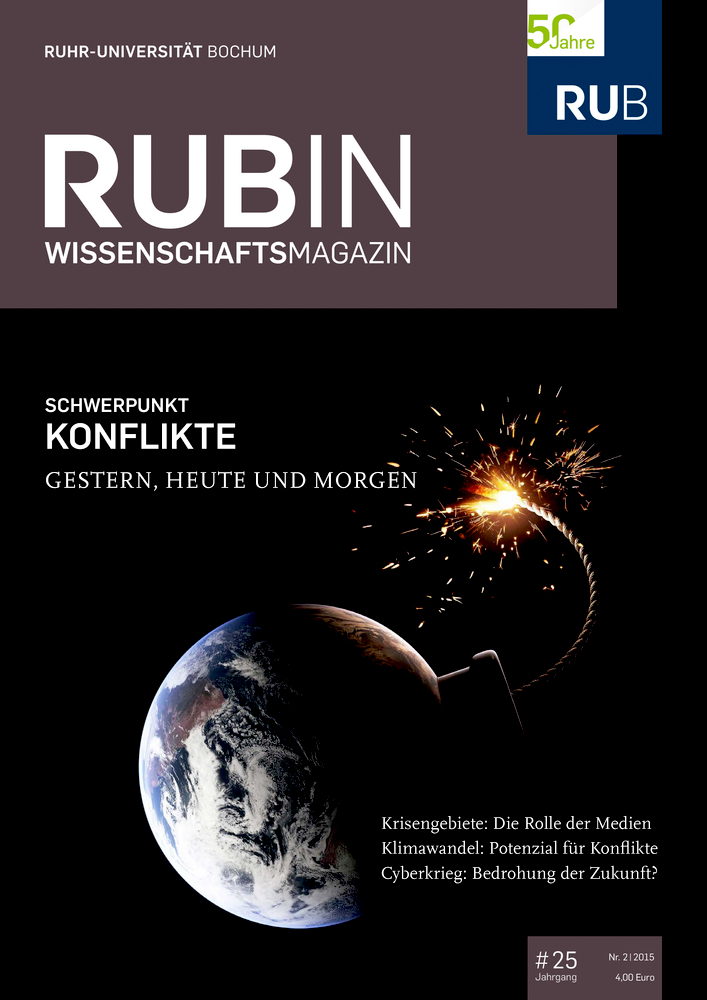Kommentar
Krieg der Daten
Der Einsatz von Daten zu Propagandazwecken ist so leicht wie nie zuvor. Doch diese Form der Cyber-Kriegsführung wird vom Völkerrecht nur unvollständig erfasst. Das muss sich ändern, meint Pierre Thielbörger.
Beim Wort Cyberwar denkt man an Hackerattacken, die durch Computermanipulation die Selbstzerstörung von Fabriken auslösen, oder an Virenangriffe, die Kraftwerke längerfristig lahmlegen. Zwar haben die Staaten, als sie sich vor etwa 100 Jahren ein „Kriegsrecht“ (nunmehr „humanitäres Völkerrecht“ genannt, weil das freundlicher klingt) selbst auferlegt haben, nicht an solche Formen der Kriegsführung gedacht.

Ob eine Fabrik durch abgeworfene Bomben oder durch eingeschleuste Viren zerstört wird, macht rechtlich kaum einen Unterschied.
Allerdings ist das humanitäre Völkerrecht durchaus auch heute in der Lage, diese damals ungeahnten Formen der Kriegsführung angemessen zu erfassen. Denn zumindest wenn die Folgen einer solchen Cyberattacke den Folgen eines Angriffs mit herkömmlichen Waffen gleichkommen, reichen die Regeln des humanitären Völkerrechts aus.
In anderen Worten: Ob eine Fabrik durch abgeworfene Bomben oder durch eingeschleuste Viren zerstört wird, macht rechtlich kaum einen Unterschied. Die altbewährten Regeln des Völkerrechts sind also durchaus zukunftstauglich.

Propaganda mit Daten ist natürlich nicht neu.
Schwieriger wird es bei einer anderen Form der Cyber-Kriegsführung, die zwar oft übersehen wird, die aber insbesondere seit der Ukraine-Krise einen neuen Höhenflug erlebt: der gezielte manipulative Einsatz von Daten zur Kriegspropaganda oder zur Destabilisierung von Staaten.
So bezeichneten russische Medien die ukrainische Regierung im Netz regelmäßig als faschistisch und charakterisierten die Unabhängigkeitsbewegung als Mehrheitsmeinung. Auch wurden von russischer Seite offenbar regelmäßig anti-europäische und pro-russische Beiträge in Onlineforen großer westlicher Zeitungen platziert und sogar Berichte mit falschen Videos und Fotos gesendet.
Propaganda mit Daten ist natürlich nicht neu. So leicht und effektiv wie heute war Datenpropaganda allerdings noch nie. Denn via Internet und sozialer Medien können ohne nennenswerte Kosten viele Menschen beeinflusst werden. Deswegen wird Propaganda durch gezielten Dateneinsatz als Mittel der Destabilisierung von Staaten und der Kriegsführung in den nächsten Jahren immer wichtiger werden.
Auch der sogenannte Islamische Staat hat unlängst entsprechende Propagandakampagnen begonnen, indem er Websites bekannter Medien kapert oder lahmlegt, wie zuletzt den französischen Sender TV5 Monde.

Im Bereich der Datenpropaganda versagt das internationale Recht.
Wo liegt nun aber das Problem aus der Sicht des Völkerrechts mit einem solchen Einsatz von Daten? Die Weltgemeinschaft hat sich die Wahrung des Weltfriedens als höchstes Ziel gesetzt. Im Bereich der Datenpropaganda versagt das internationale Recht diesbezüglich aber, obwohl sie gerade zunehmend zur Bedrohung der internationalen Sicherheit wird.
Denn Interventionen eines Staates in die Angelegenheiten eines anderen Staates sind im internationalen Recht nur verboten, wenn sie einen „zwingenden“ Charakter haben. Die Schwelle für einen solchen zwingenden Eingriff liegt aber sehr hoch.
Als Anwendung von Gewalt, die zwischen Staaten verboten ist, kann der Einsatz von Daten oft erst recht nicht eingestuft werden. Denn hierfür wird nach herkömmlichem Verständnis der tatsächliche Einsatz militärischer Mittel gefordert. Viele Dateneinsätze zu Propagandazwecken fallen also durch das Raster: Sie sind weder verbotene Interventionen in die Angelegenheiten eines anderen Staates noch stellen sie eine Gewaltanwendung gegen andere Staaten dar.

Wünschenswert wäre es, wenn Staaten sich auf einen neuen internationalen Vertrag einigen, der manipulative Dateneinsätze juristisch klar einordnet.
Hier muss umgedacht werden. Denn Beispiele wie die Ukraine zeigen, wie oft der Dateneinsatz zu Propagandazwecken in engstem Zusammenhang mit einer geplanten – und in der Ukraine sogar tatsächlich erfolgten – Gewaltanwendung steht. Der Dateneinsatz kann die Gewaltanwendung begünstigen, gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen oder sogar, durch subversive Beeinflussung von Gesellschaften, erst ermöglichen.
Das Völkerrecht muss Mittel und Wege finden, solchen Dateneinsätzen durch klare rechtliche Kriterien entgegentreten zu können, wenn es die internationale Sicherheit effektiv schützen will.
Wünschenswert wäre es, wenn Staaten sich auf einen neuen internationalen Vertrag einigen, der manipulative Dateneinsätze juristisch klar einordnet: Was ist erlaubt und was verboten?
Auf solch ein klarstellendes Vertragswerk zu warten, könnte sich allerdings, um es mit Samuel Beckett zu sagen, leicht als „Warten auf Godot“ entpuppen: Godot kommt schlichtweg nicht. Solange dies der Fall ist, muss sich das internationale Recht in der Tat die Frage gefallen lassen, ob die Definitionen für Interventions- und Gewaltverbot für propagandistische Dateneinsätze jedenfalls teilweise neu gefasst werden müssen.