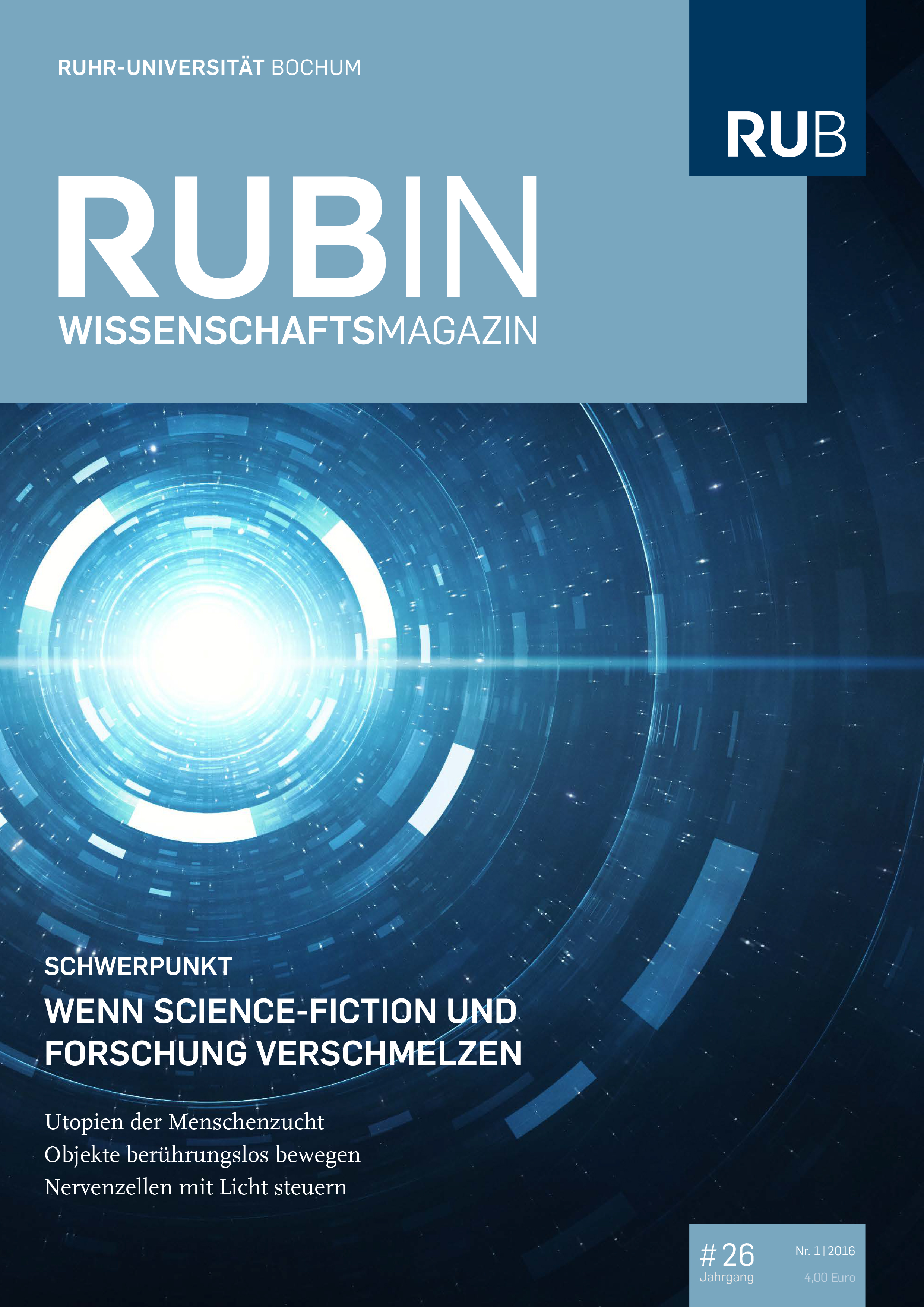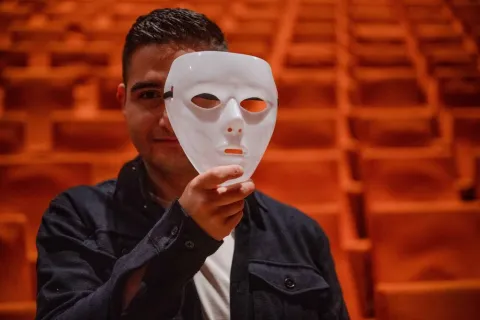Science-Fiction
Wenn Forscher ihrer Zeit voraus sind
Visionen über zukünftige Technologien und Lebensweisen haben viele Forschungsarbeiten geprägt. Meist waren sich die Wissenschaftler gar nicht bewusst, wie nahe sie der Science-Fiction damit kamen.
Herr Rieger, Sie sind Professor für Mediengeschichte und Kommunikationstheorie. Welche Rolle spielt Science-Fiction in Ihrem Fach?
Medienwissenschaft erzählt nicht nur die Geschichte von technischen Apparaten, wie oft angenommen wird. Jenseits dessen gibt es eine sehr eigene Geschichte, die mit Phantasmen, Träumen, Ideen, Erwartungen und nicht zuletzt mit Ängsten zu tun hat. Das ist das Einfallstor für Science-Fiction. Die dort ausgehandelten Utopien und Dystopien sind es, die mich persönlich sehr interessieren.
Haben Sie ein Beispiel für eine wissenschaftliche Arbeit, die zu Ihrer Zeit wie Science-Fiction anmutete?
Ja, sogar gleich zwei: eines aus dem ausgehenden 18. und eines aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Beide nehmen technische Möglichkeiten vorweg, die so zu der jeweiligen Zeit noch nicht realisiert waren. Das erste erzählt von einem Gedankenexperiment, das Immanuel Kant in seiner „Kritik der Urteilskraft“ von 1790 durchgeführt hat. Als Philosoph fragte er sich, wie Menschen zu Begriffen kommen. Konkret, wie es zur Definition eines schönen Mannes komme.
Für Kant gab es zwei Möglichkeiten: Entweder man macht es mathematisch, nimmt also die Daten von 1.000 attraktiven Männern, bildet den Mittelwert und kann dann sagen: Ein schöner Mann ist so und so groß, so schwer und hat die und die Körpermaße. Oder aber, und das ist für uns der interessantere Ansatz, man nimmt von jedem dieser Männer ein Bild und druckt es auf transparente Folie. Dann legt man die Fotos übereinander. Die Stellen, an denen sich die Männer ähneln, werden dabei erkennbar; individuelle Besonderheiten treten dagegen zurück. Kant beschrieb also einen optischen Automatismus, um einen Durchschnittstypen zu ermitteln.
Und das ist Science-Fiction?
Das Interessante ist, dass Kant damals weder die Fotografie im Allgemeinen noch die sogenannte Kompositfotografie, also die Überlagerungsfotografie, kannte. Erst rund 100 Jahre später, bei Francis Galton, einem britischen Naturforscher und Eugeniker, wurde das Verfahren Realität. Das Gedankenexperiment von Kant hat also das technische Verfahren der Überblendungsfotografie und damit der späteren Typenbilder vorweggenommen.
Erzählen Sie uns von dem zweiten Beispiel.
Es handelt von dem 1792 geborenen Naturforscher Karl Ernst von Baer. Er überlegte, wie man die Wahrnehmung eines Moments durch verschiedene Tiere darstellen könnte. Menschen können ungefähr 18 Eindrücke pro Sekunde aufnehmen. Was schneller ist, zum Beispiel eine abgeschossene Gewehrkugel, können wir, jedenfalls ohne Medien, nicht wahrnehmen. Im Tierreich gibt es aber ganz andere Wahrnehmungsschwellen. Von Baer überlegte sich, wie man diese andere Wahrnehmung darstellen könnte.

Aufgeschrieben hat er das als wissenschaftliche Abhandlung. Der Text liest sich aber stellenweise wie fantastische Literatur.
Aufgeschrieben hat er das als wissenschaftliche Abhandlung. Der Text liest sich aber stellenweise wie fantastische Literatur. Er macht Prozesse, die man nicht sehen kann – etwa das Wachsen einer Pflanze oder das Vibrieren einer Saite –, im Modus von Sprache vorstellbar. Damals kannte man noch keine Kinematografie. Trotzdem hat von Baer Phänomene der Raffung und Dehnung von Zeit in der visuellen Wahrnehmung vorweggenommen und diese jeweiligen Taktungen an unterschiedlichen Tieren und Pflanzen veranschaulicht. Er hat also über technische Möglichkeiten nachgedacht, wie sie erst die Kinematografie hervorbringen sollte.
Heißt das, wenn wir Science-Fiction-Romane lesen, bekommen wir tatsächlich ein Bild davon, wie die Welt in 200 Jahren aussehen wird?
Ich glaube das nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Schriften von Jules Verne oder auch die von seinem deutschen Pendant, Kurd Laßwitz. Wir lesen dort in Literatur gegossene Zukunftsentwürfe, die in ihrer Zeit einigermaßen radikal waren. Dennoch wirken sie, wenn ich sie heute lese, irgendwie anrührend altmodisch. Die Texte erzeugen eine ganz eigene Nostalgie, weil sie weniger von der Zukunft selbst, als vom Alt- und Obsolet-Werden von Zukunftsentwürfen handeln.

Forschung ist längst nicht so zielgerichtet, wie viele glauben.
Ist es Wissenschaftlern bewusst, dass sie Science-Fiction betreiben, wenn sie neue Technologien entwickeln?
Nein, das wohl nicht. Forschung ist längst nicht so zielgerichtet, wie viele glauben. Man sagt sich nicht: Ich erfinde jetzt dieses oder jenes, das wird dann gebaut und findet Anwendung. Man kann das nur selten so planen. Wie neuere Arbeiten aus der Wissenschaftsgeschichte zeigen, spielen gerade Zufälle und Unfälle eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Welche Rolle spielen Moral und Ethik in der zukunftsorientierten Forschung? Ist alles erlaubt, solange es nur fortschrittlich ist?
Die Auswirkungen sowohl auf Politik als auch auf Ethik standen lange Zeit nicht auf der Agenda. Heute jedoch schon. Nehmen wir das Beispiel der selbstfahrenden Autos. Technisch könnte man die Idee schon seit vielen Jahren umsetzen. Was die Industrie daran hindert, sind Akzeptanzfragen der Nutzer, vor allem aber juristische, zum Beispiel versicherungsrechtliche Aspekte. Wer haftet beispielsweise bei einem Unfall? Wie versichert man so ein Auto?
Solche Fragen haben mit Ethik zu tun – aber eben nicht mehr nur mit einer Ethik des Menschen, sondern auch einer der Maschinen. Wenn Fahrzeuge in Abhängigkeit vom Gesundheitszustand ihrer Fahrer und ohne deren Zutun den Verkehr einstellen oder wenn in der Pflege eingesetzte Roboter die Lage am Lebensende bestimmen, ist eine Neuverhandlung der Zuständigkeiten mehr als überfällig.
Welche Forschungsfelder werden für unsere Zukunft die größte Rolle spielen?
Das sind die NBIC-Converging-Technologies. Gemeint sind die Nano-, die Bio-, die Kognitions- und die Informationstechnologie. Experten sind sich sicher, dass diese vier Bereiche in Zukunft immer enger zusammenarbeiten werden. Die daraus entstehenden Möglichkeiten werden unser zukünftiges Leben bestimmen – und zwar auf eine Weise, die von der literarischen Science-Fiction verfehlt werden wird.