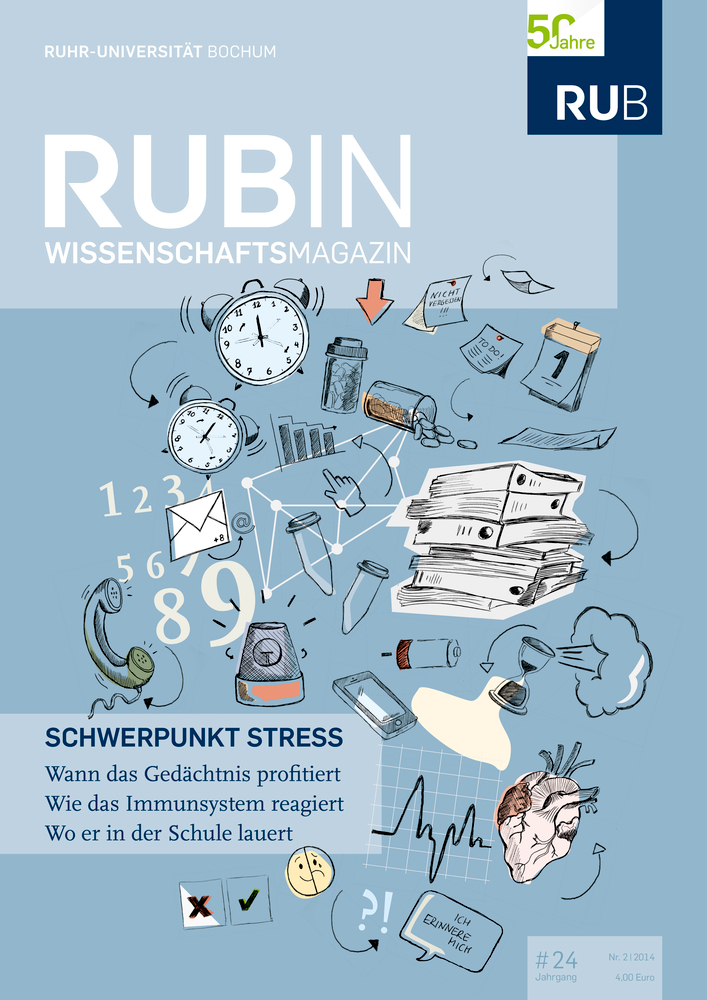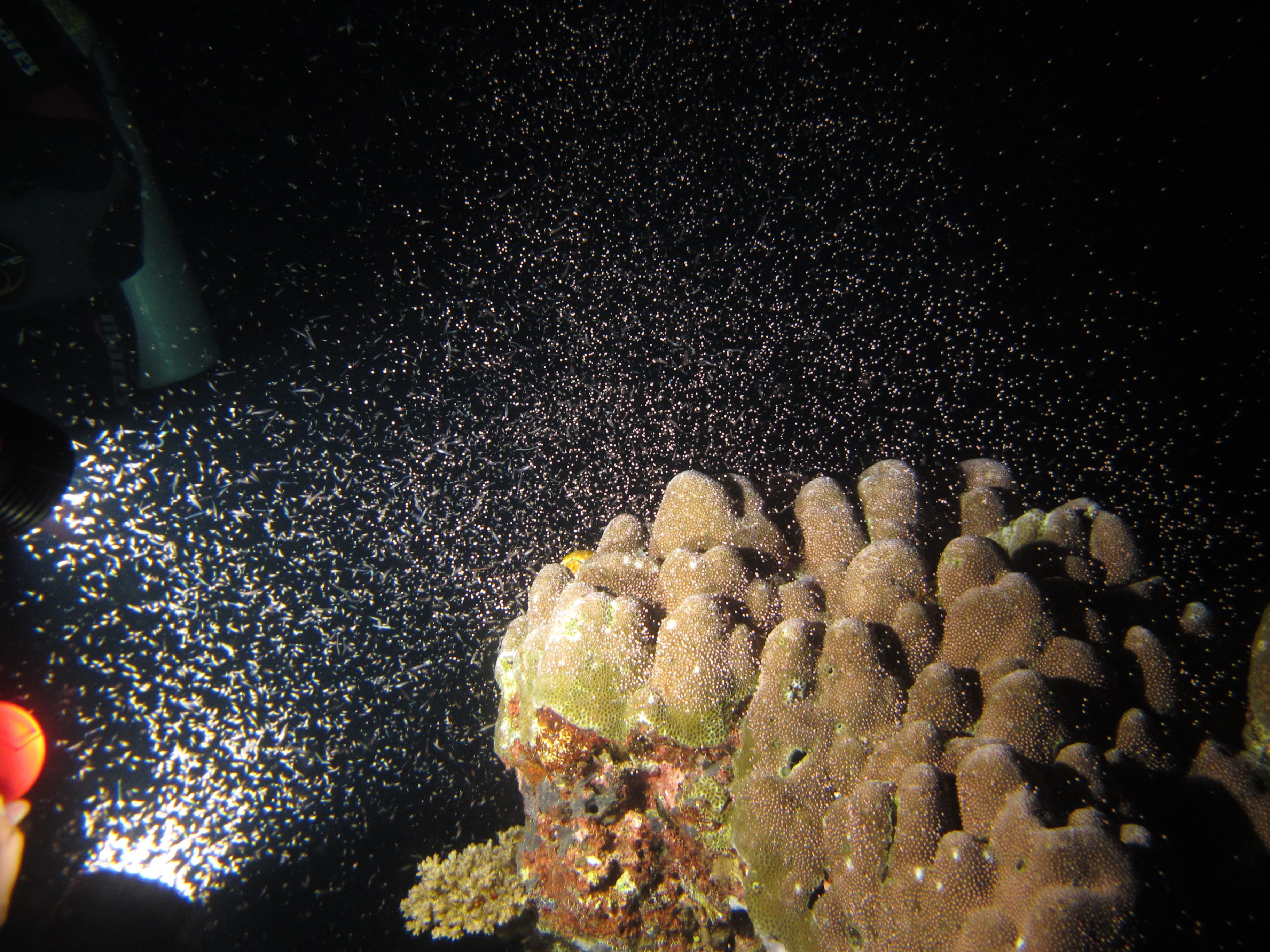Psychologie
Stress ist besser als sein Ruf
Der Abruf von Gelerntem unter Stress funktioniert zwar nicht gut. Aber Stress kann auch beim Lernen helfen. Und er schützt die Seele vor belastenden Erinnerungen.
Stress hat einen schlechten Ruf. Er fühlt sich nicht gut an, macht uns unruhig und blockiert unsere Erinnerung: Warum sonst fallen einem ausgerechnet in der mündlichen Prüfung die entscheidenden Antworten nicht mehr ein, die man sonst im Schlaf geben würde? „Teilweise hat Stress diesen schlechten Ruf zurecht, aber er hat zwei Seiten“, sagt Prof. Dr. Oliver Wolf, Neurowissenschaftler der Fakultät für Psychologie der RUB.
Wie funktioniert Lernen unter Stress?
Was viele selbst aus Prüfungssituationen kennen, stimmt tatsächlich: Unter akutem Stress fällt es uns schwerer, gelernte Informationen aus dem Gedächtnis abzurufen. Schon vor einigen Jahren konnten Oliver Wolf und Kollegen allerdings auch zeigen, dass Stress durchaus auch positive Wirkungen auf das Gedächtnis hat.
Wenn Stress direkt vor oder nach dem Wissenserwerb auftritt, verbessert sich die Konsolidierung des Gedächtnisses, das heißt, Informationen werden besser dauerhaft abgespeichert. Ausschlaggebend dafür ist das Stresshormon Cortisol – der Effekt trat in Studien auch auf, wenn die Probanden es als Tablette kurz vor oder nach dem Lernen einnahmen.
Um das Verhältnis von Stress und Gedächtnis genauer zu untersuchen, rückten die Forscher die Stressphase selbst in den Fokus: Wie funktioniert Lernen unter Stress? Oder anders gefragt: An was erinnert man sich aus einer stressigen Episode?
Fingierte Bewerbungsgespräche
Für die Studie im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 874 „Integration und Repräsentation sensorischer Prozesse“ wurden 60 Versuchspersonen in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen nahmen an einem fingierten Bewerbungsgespräch teil. Die eine vor einem zweiköpfigen Gremium in weißen Kitteln mit unbewegten Gesichtern, das neutral agierte. Dabei wurden die Teilnehmer auf Video aufgezeichnet.

Die andere Gruppe traf auf dasselbe Gremium, allerdings ohne Kittel, freundlich und zugewandt, lächelnd und nickend. Eine Videoaufzeichnung gab es nicht. Während des achtminütigen freien Vortrags der Probanden hantierte das Gremium in beiden Fällen beiläufig mit verschiedenen Gegenständen wie einem Anspitzer oder einem Wasserglas. Andere Gegenstände, zum Beispiel ein Locher, lagen zwar auf dem Tisch, wurden aber nicht benutzt. Den Stresslevel bestimmten die Forscher zu verschiedenen Zeitpunkten vor und nach der Stresssituation bzw. der Kontrollsituation, indem sie den Cortisolgehalt im Speichel maßen.
Am folgenden Tag zeigten die Wissenschaftler den Versuchspersonen Fotos von den Gegenständen, die in der Bewerbungssituation auf dem Tisch gelegen hatten, denen, mit denen das Gremium agiert hatte und solchen, die in der Situation gar nicht vorgekommen waren. Die Probanden mussten angeben, ob sie die entsprechenden Gegenstände am Vortag gesehen hatten oder nicht.

Möglicherweise ein evolutionärer Vorteil
Oliver Wolf
„Es kam heraus, dass die gestressten Personen sich besser an die Gegenstände erinnern konnten als die entspannten“, fasst Oliver Wolf zusammen. „Ganz besonders die Dinge, mit denen sich die Mitglieder des Gremiums beschäftigt hatten, waren ihnen im Gedächtnis geblieben.“ Letzteres führte zu der Interpretation, dass es beim Erinnern besonders darauf ankommt, wie eng ein Gegenstand mit dem Stressor verbunden war.
„Darin liegt möglicherweise ein evolutionärer Vorteil: Emotional wichtige Dinge sind in Stresssituationen bedeutender als neutrale und werden daher besser abgespeichert“, meint Oliver Wolf. Diese Erkenntnisse geben auch Hinweise auf Mechanismen, die bei der Entstehung von sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen ablaufen. Dabei werden Menschen, die eine lebensbedrohliche Situation durchlebt haben, immer wieder von Erinnerungen und Albträumen heimgesucht, die mit dem bedrohlichen Ereignis in Verbindung stehen.
Stress und Gedächtnis
Ebenfalls für klinische Fragen bedeutsam ist die Arbeit im Rahmen der Forschergruppe 1581, an der Oliver Wolf beteiligt ist und die die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert. Sie befasst sich mit einem anderen Phänomen im Zusammenhang von Stress und Gedächtnis: dem Extinktionslernen, also der Löschung von Gedächtnisinhalten.
Zwar kann vom eigentlichen Löschen nicht die Rede sein, da Gedächtnisinhalte nicht verschwinden, sondern eher von einer zweiten Gedächtnisspur überlagert werden. Der Effekt aber ist ähnlich: Einmal Gelerntes – in klinischen Zusammenhängen zum Beispiel übersteigerte Angst vor etwas – wird verlernt. Auch hier fragten sich die Forscher, welche Rolle Stress spielt: Wenn er den Abruf von Gedächtnisinhalten behindert, dann vielleicht auch den Abruf von gelernter Angst.
Strömstöße machen Angst vor Bildern
An einem entsprechenden Experiment nahmen 40 Männer teil. Alle Probanden unterzogen sich zunächst einer Lernphase: Eine Elektrode, über die Stromstöße verabreicht werden konnten, wurde an ihrem Schienbein befestigt. Gemeinsam mit den Probanden fanden die Forscher die Stromstärke heraus, die unangenehm, aber nicht schmerzhaft war.

Am Bildschirm wurde den Probanden dann das Bild eines Büros gezeigt, in dem sich eine Schreibtischlampe befand, die in verschiedenen Farben aufleuchtete. Leuchtete sie rot oder gelb, wurde dem Probanden in zwei Dritteln der Fälle kurz danach ein Stromstoß versetzt. Bei blauem Licht folgte kein Stromstoß. Messungen der Hautleitfähigkeit, die Aufschluss über die emotionale Erregung geben, zeigten, dass die Probanden mit der Zeit die Stromstöße immer stärker vorwegnahmen, also fürchteten.
Dann präsentierten die Forscher den Probanden ein Bild von einem anderen Büro, das die gleiche Lampe enthielt, sie erschien also in anderem Kontext. Diesmal wurde bei gelbem und blauem Licht kein Stromstoß versetzt, rotes Licht kam gar nicht vor. Dadurch löschten die Forscher die gelernte Information, dass bei gelbem Licht mit großer Wahrscheinlichkeit ein unangenehmer Reiz folgt.
Am folgenden Tag wurde die Hälfte der Probanden gestresst: Sie mussten ihre Hand für drei Minuten in Eiswasser tauchen und wurden dabei per Video aufgezeichnet. Die andere Hälfte der Gruppe tauchte die Hand in körperwarmes Wasser und wurde nicht gefilmt, wurde also nicht gestresst.

20 Minuten später testeten die Forscher dann, wie erfolgreich die Extinktion der gelernten Angst vor dem Stromstoß war. Sie zeigten beiden Gruppen beide Bildschirme vom Vortag. Diesmal wurde den Teilnehmern beim Aufleuchten der Lampe in egal welcher Farbe kein Stromstoß versetzt. „Die Probanden, die vorher ihre Hand in Eiswasser gehalten hatten, fürchteten den unangenehmen Reiz wesentlich weniger stark als diejenigen, die keine Stresssituation durchgestanden hatten“, sagt Oliver Wolf. Das galt für beide Büro-Kontexte, sowohl das Bild aus der Lernsituation als auch das Bild aus der Extinktionssituation.

Diese Ergebnisse sind wichtig für die Behandlung von Angstpatienten.
Oliver Wolf
„Diese Ergebnisse sind wichtig für die Behandlung von Angstpatienten“, sagt Oliver Wolf. „Bei ihnen kehrt die Angst, die sie in der Therapie verlernt haben, im Alltag häufig zurück. Die Angst ist also kontextabhängig.“ Dass bei gestressten Probanden die Furcht auch beim Betrachten des Büro-Kontexts aus der Lernsituation weniger stark zurückkehrte, lässt hoffen, dass Stresshormone dabei helfen können, die Angst kontextunabhängig zu verlernen.
Die Erkenntnisse der Studie passen zu älteren Befunden der Arbeitsgruppe, die besagen, dass unter Stress besonders der Abruf von emotionalem Material blockiert wird. „Hier scheint Stress also durchaus eine schützende Funktion zu haben“, unterstreicht Wolf.