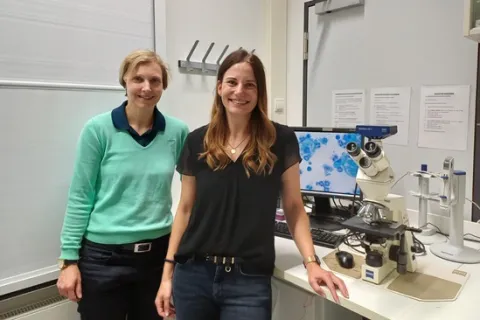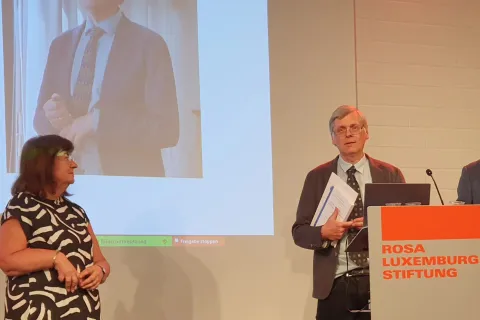Interview
Wie Jugendlichen der Ausstieg aus der Sucht gelingen kann
Auf Partys durchtanzen oder Stress abbauen wollen – das sind häufige Gründe für Drogenkonsum, der in der Abhängigkeit im jungen Erwachsenenalter enden kann.
Wie man Jugendliche beim Ausstieg aus der Sucht unterstützen kann, haben Experten im RUB-Universitätsklinikum in Hamm diskutiert. Auch Dr. Moritz Noack, Oberarzt in der Abteilung für Suchttherapie der kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik des Landesverbands Westfalen-Lippe (LWL), war bei dem Symposium am 21. Juni 2017 dabei. Im Interview erzählt er von Suchtgefahren und Behandlungsmöglichkeiten.
Herr Dr. Noack, welche Drogen sind derzeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbreitet?
Am häufigsten konsumiert werden die Substanzen Alkohol und Nikotin, die zwar nicht für jedes Alter, aber in der Gesellschaft am leichtesten verfügbar sind. Cannabis ist darüber hinaus die häufigste illegale Droge, die konsumiert wird.
Oft werden Drogen heutzutage verwendet, um auf Partys aktiv zu sein, positive Erfahrungen im Drogenrausch zu machen, aber auch Stress und Konflikte abzubauen: Deshalb sind vor allem entspannende Drogen wie Cannabis, Nikotin und Alkohol, aber auch stimulierende Drogen wie Amphetamine, etwa Speed und Ecstasy angesagt. Weitere Drogen wie Kokain und Heroin spielen heutzutage eher eine seltene Rolle bei Jugendlichen. Eine kleinere Gruppe experimentiert darüber hinaus mit diversen chemischen und pflanzlichen Drogen.

In welchem Alter kommen die Jugendlichen in Kontakt mit diesen Drogen?
Das hängt sehr davon ab, wie verfügbar die legalen und illegalen Substanzmittel sind. Bundesweite Befragungen in der Bevölkerung zeigen, dass mit 14 Jahren Alkohol und Nikotin ausprobiert wird sowie mit 16 Jahren die ersten Erfahrungen mit Cannabis gemacht werden. Dabei wird der Umgang mit Alkohol und Nikotin häufig zuerst in der Familie gelernt. Illegale Drogen auszuprobieren gehört am Beispiel des Cannabis mittlerweile auch häufig zur Entwicklung im Jugendalter.
Das gilt natürlich nicht für alle Drogen, vor allem weil 80 Prozent der Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, keine weitere illegale Droge probieren. Eine kleine Subgruppe ist aber gefährdet, auch weitere Drogen zu konsumieren, soziale und psychische Schäden sowie Abhängigkeiten zu entwickeln. Diese Gruppe von Jugendlichen beginnt meistens schon viel früher, Alkohol, Nikotin und Drogen zu konsumieren. Für diese Jugendlichen gibt es Beratungs- oder Therapieangebote wie zum Beispiel das „Drug-Out“-Programm in der LWL-Universitätsklinik Hamm.
Wie erkenne ich als Elternteil, dass mein Kind behandlungsbedürftig ist?
Am ehesten, wenn sich das Kind zurückzieht, sich in der Persönlichkeit verändert sowie in der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis Schwierigkeiten bekommt. Oft passieren diese Veränderungen allerdings schleichend, und der Drogenkonsum wird verheimlicht. Dann kommt man erst allmählich dahinter.

Drogenkonsum offen in der Familie anzusprechen ist wichtig.
Drogenkonsum offen in der Familie anzusprechen, ist schwierig – ist aber wichtig, um gegenseitige Erwartungen und Grenzen zwischen Eltern und Kindern zu besprechen. Sollte das nicht mehr gelingen, ist Hilfe und Beratung durch eine externe Stelle häufig notwendig. Eine Behandlungsbedürftigkeit ergibt sich meist erst viel später, wenn anhaltende schädliche Konsummuster oder Abhängigkeitserkrankungen bereits entstanden sind.
An wen können sich Betroffene oder deren Eltern wenden?
Es gibt viele unterschiedliche Ansprechpartner im Helfersystem. Spezifisch auf Drogenkonsum ausgerichtet sind Suchtberatungsstellen. Auch Erziehungsberatungsstellen und die Jugendhilfe beschäftigen sich viel mit dem Thema oder können weitervermitteln. Außerdem gibt es im Internet zunehmend Beratungs- und Präventionsangebote.
Auf Beratungsangebote folgen später ambulante oder zumeist stationäre suchtspezifische Behandlungsangebote wie in unserer Klinik. Wichtig ist es, dass sich die Anlaufstellen im Suchthilfesystem gegenseitig gut vernetzen. Auch aus diesem Grund richten wir die Informationsveranstaltung „Suchttherapie“ jedes Jahr in der LWL-Universitätsklinik Hamm aus.
Wie sieht eine Behandlung aus?
Eine stationäre Suchttherapie ist für diejenigen Patienten notwendig, die zuhause keine Abstinenz mehr herstellen können. Als erste Schritte folgen eine Entzugsbehandlung und der schrittweise Aufbau eines drogenfreien Alltags in der Klinik. Die Patienten lernen auch, alternative Alltags-, Stress- und Konfliktstrategien zu entwickeln für die vielen Situationen, in denen vorher die Drogen eingesetzt worden sind.
Gelingt vielen jungen Menschen der Ausstieg aus ihrer Sucht?
Die Beratungs- und Therapieerfolge sind unterschiedlich und neben der Motivation des Jugendlichen auch immer von der Unterstützung durch die Eltern, Familie, Freunde und andere Helfer abhängig. Generell kann man aber sagen: Je früher eine Beratung und Therapie begonnen werden kann, umso eher kann in einem positiven Verlauf eine schädliche Drogenkonsumphase oder Abhängigkeitserkrankung unterbrochen werden. Der Ausstieg fällt dann zumeist leichter.

Das Risiko für einen Rückfall in alte Verhaltensschemata ist am alten Wohnort häufig am höchsten.
Wie sieht eine erfolgreiche Nachbehandlung aus?
Vor einer Rückkehr in die alte Umgebung ist es wichtig, die familiären und sozialen Beziehungen zu überprüfen, da diese durch den Drogenkonsum häufig gelitten haben. Das Risiko für einen Rückfall in alte Verhaltensschemata ist am alten Wohnort häufig am höchsten. Deshalb ist diese Rückkehr gut vorzubereiten. Für einige Jugendliche bieten auch spezialisierte Einrichtungen der Jugendhilfe, wie etwa das „Auxilium“ unseres Kooperationspartners Malteser-Werke Hamm, nach der Klinik eine wichtige Alternative, um weitere Schritte zurück in die Gesellschaft zu erlernen.