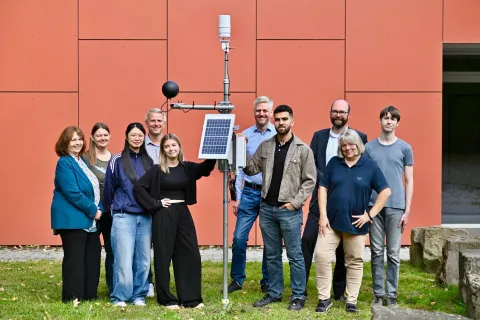Umwelttechnik
Hochwasserrisiko besser abschätzen
Seit 1993 sind in Deutschland vermehrt Flüsse über die Ufer getreten. Ein Beleg für den Klimawandel?
Hochwasser im Gebiet der Elbe ist keine Seltenheit. Doch die Flut 2002 traf die Bevölkerung weitestgehend unvorbereitet. Häuser, Straßen und Brücken fielen den Wassermassen zum Opfer, teilweise brachen Strom- und Telefonversorgung zusammen, Dörfer waren von der Außenwelt abgeschnitten. Die Schäden in Deutschland beliefen sich am Ende auf 9 Milliarden Euro, einige Menschen verloren in der Flut ihr Leben.
2013 wurde Mitteleuropa erneut von einem extremen Hochwasser heimgesucht, und auch die Elbe trat wieder über die Ufer. Doch die Schäden in Sachsen waren weitaus geringer als elf Jahre zuvor. Der Freistaat hatte nach den Erfahrungen von 2002 in neue Hochwasserschutzanlagen investiert. An den Grundlagen dafür war das Team um Prof. Dr. Andreas Schumann vom Bochumer Lehrstuhl für Hydrologie, Wasserwirtschaft und Umwelttechnik beteiligt gewesen. „2002 wurde klar, dass die statistischen Modelle für die Vorhersage von extremen Hochwasserereignissen nicht mehr passen“, erzählt er. Stattdessen waren extreme Hochwasser wahrscheinlicher, als das Modell dies prognostizierte. Die Bochumer Hydrologen entwickelten ein neues statistisches Modell, das sie seither immer weiter optimieren.
Drei Ursachen für Hochwasser
Im Rahmen einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsgruppe gehen die Bochumer Ingenieure den Ursachen extremer Hochwasser in Deutschland auf den Grund und verbessern so die statistischen Bewertungsmöglichkeiten. In ihrem Modell unterscheiden sie drei Arten von Hochwasser, die auf verschiedene Ursachen zurückgehen: Starkregen, der nur ein oder zwei Tage andauert; Dauerregen über drei und mehr Tage; und schneebeeinflusste Hochwasser durch Schneeschmelze.

Früher wurden die Jahreshöchstwerte statistisch analysiert, das statistische Modell unterschied also nicht zwischen den drei Hochwassertypen. Genau das ist aber notwendig, um die Hochwasserwahrscheinlichkeit abzuschätzen. Ein kurzer, lokal begrenzter Starkregen kann zum Beispiel in kleineren Gebieten die Flüsse über die Ufer treten lassen, in größeren Gebieten aber nicht. „Der Rhein in Köln kann Hochwasser nur in Folge von Dauerregen führen, weil lokale Regen räumlich ausgeglichen werden“, veranschaulicht Schumann.
Wetterdaten und Pegelstände zusammenbringen
Seine Gruppe rechnete die drei Hochwassertypen für das neue Modell mühsam auseinander. Dazu schauten die Forscherinnen und Forscher zurück bis zum Beginn der Beobachtungsreihen, die in Einzelfällen 150 Jahre, meist zwischen 50 und 70 Jahre zurückreichten. Sie entwarfen für jeden Hochwassertyp eine eigene Statistik, die die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses berechnet. Als Grundlage erhielten sie von den jeweiligen Landesämtern Aufzeichnungen der Abflussdaten bestimmter Flüsse und setzten diese mit meteorologischen Daten des Deutschen Wetterdienstes zum gleichen Zeitpunkt in Beziehung. So erhielten sie eine Statistik, welche Wetterereignisse welche Effekte in den Flüssen auslösen und können darauf basierend Aussagen zum Hochwasserrisiko für die Zukunft ableiten. Prinzipiell funktioniert das Modell für ganz Deutschland, allerdings muss es für jedes Gebiet angepasst werden.
Denn wichtig für eine möglichst gute Aussage sind auch die Randbedingungen jeder Region. Dazu zählen Bodenfeuchte, Bewaldung, ob und wie ein Gebiet landwirtschaftlich genutzt oder bebaut ist sowie das Relief des Geländes, das zum Beispiel bedingt, ob es eine steile oder flache Flutwelle gibt und wie schnell das Hochwasser abläuft.
Hochwasser treten unregelmäßig auf
Das neue statistische Modell basiert auf Daten des Flusses Mulde und dem Gebiet Ostharz. „Wir können nun ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass in einem beliebigen Jahr eine bestimmte Art von Hochwasser auftritt“, resümiert Schumann. Allerdings sind die Ereignisse nicht gleichmäßig über die Zeit verteilt. „1993 und 1995 gab es am Rhein Hochwasser, die beide so stark waren, dass sie theoretisch nur einmal in einhundert Jahren hätten auftreten sollen. Aber sie lagen zeitlich eng beieinander, und bereits 1920 und 1926 hatte es ähnlich große Hochwasserereignisse gegeben“, so der Ingenieur. Die Elbe-Hochwasser 2002 und 2013 sind ein weiteres Beispiel für eine solche Unregelmäßigkeit. „Zuvor war Dresden nur einmal so stark überschwemmt gewesen, nämlich 1845. Dann passierte es gleich zweimal innerhalb von zwölf Jahren“, verdeutlicht Schumann.
Gemeinsam mit Meteorologinnen und Meteorologen der Goethe-Universität Frankfurt suchen die Bochumer Ingenieure derzeit nach einer Erklärung für die zeitliche Abfolge der Extremereignisse. Hochwasserarme und hochwasserreiche Perioden kann das Modell bislang nicht berücksichtigen. Die Kooperationspartner wollen auch verstehen, warum gewisse Regionen häufig gemeinsam unter Hochwasser leiden. Warum treten Sommerhochwasser häufig an Elbe und Donau gemeinsam auf? Warum ist der Rhein in der Regel nicht gleichzeitig betroffen? Solche Fragen wollen die Forscher künftig beantworten können.

Natürlich stellt sich immer die Frage, ob das die Folgen des Klimawandels sind.
Andreas Schumann
Klar ist: Seit ungefähr 1993 befindet sich Deutschland in einer hochwasserreichen Zeit. „Natürlich stellt sich immer die Frage, ob das die Folgen des Klimawandels sind“, weiß Andreas Schumann. „Aber bislang sind die Messreihen nicht lang genug, um einen solchen Zusammenhang zu belegen. Hochwasserreiche Perioden hat es auch schon früher gegeben.“ Trends zeichnen sich hingegen ab: Schneehochwasser sind seltener geworden; Hochwasser durch Starkregen häufiger – statistisch signifikant ist das jedoch derzeit nicht.
Damit das Modell auch künftig korrekte Vorhersagen liefert, ist es wichtig, es kontinuierlich anzupassen. Denn die Randbedingungen ändern sich ständig, zum Beispiel durch den Bau von Deichen. Dadurch sinkt zwar das Hochwasserrisiko in dem Gebiet mit den neuen Schutzanlagen, so wie es in Sachsen der Fall war. Gleichzeitig steigt das Risiko in anderen Gegenden. „Die Hochwasserwelle, die von den Deichen in Sachsen zurückgehalten wird, wird weitergegeben“, erklärt Schumann. „Sie bricht dann in Sachsen-Anhalt aus dem Flussbett aus. Und wenn dort ebenfalls verbesserte Hochwasserschutzanlagen errichtet werden, ist Brandenburg als Nächstes dran.“
Beim Bau des eigenen Hauses vorsorgen
Der beste Hochwasserschutz ist laut dem Bochumer Ingenieur immer noch, die Überschwemmungsgebiete der Flüsse nicht zuzubauen – aber das ist kaum realisierbar. Er empfiehlt jedem Bürger und jeder Bürgerin, sich mit dem Thema Hochwasser auseinanderzusetzen. „Die Leute müssen sensibler für dieses Problem werden“, sagt Schumann. „Nach den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 ist der Bund für die Schäden aufgekommen, das wird sich nicht auf Dauer realisieren lassen. Betroffene bleiben dann auf den Kosten sitzen.“ Vorsorge treffen können Eigentümer durch eine Versicherung, die aber teuer ist – gerade in Risikogebieten. Aber sie können den Hochwasserschutz auch schon beim Bau mitdenken.
In besonders gefährdeten Gebieten gibt es bereits ein Verbot für Ölheizungen, damit sich im Schadensfall kein Wasser-Öl-Gemisch bilden kann, das nie wieder aus den Häusern zu entfernen ist. Bislang existieren jedoch nur wenige solche Bauvorschriften. „Aber auch ohne Gesetz kann man überlegen, ob es gut ist, die Elektroinstallation in den Keller zu bauen, bodentiefe Fenster zu installieren und die Türschwelle wegzulassen, wenn man in einem Überschwemmungsgebiet wohnt“, meint Schumann. Sicher vor einem Hochwasser sei niemand: „Ich höre immer das Argument: ‚Ich wohne hier schon seit 50 Jahren, und es gab noch nie ein Hochwasser‘“, zitiert der Forscher. „Das heißt aber nicht, dass das Gebiet nicht in zwei Jahren zwei Meter hoch unter Wasser stehen kann.“

Bei einem Hochwasser hat man in den Millionenstädten Afrikas schnell Betroffenenzahlen, die alle Grenzen überschreiten.
Andreas Schumann
Mehr noch als die Hochwassergefahren in Deutschland treiben den Ingenieur aber Probleme in anderen Ländern um. „Deutschland hat die Kapazität, mit den wirtschaftlichen Schäden nach einem Hochwasser umzugehen“, sagt er. „In den wachsenden Millionenstädten in Afrika können durch ein Hochwasser ganze Volkswirtschaften zusammenbrechen.“ Hinzu komme das Problem, dass die Ärmsten genau dort siedeln, wo die Gefahr am größten ist: Slums entstehen bevorzugt in Flusstälern, in die kein teures Gebäude gebaut werden würde. „Bei einem Hochwasser hat man dort schnell Betroffenenzahlen, die alle Grenzen überschreiten“, erzählt Schumann. 2019 geht der Ingenieur in Ruhestand. Dann möchte er sich verstärkt in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren.