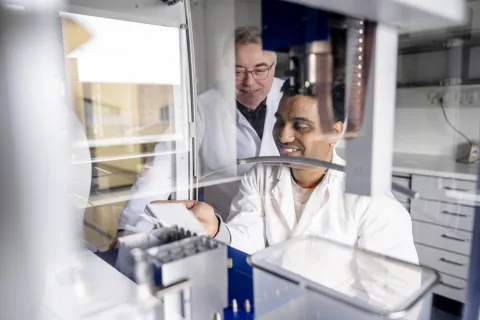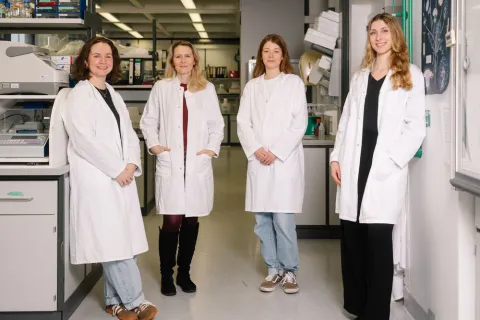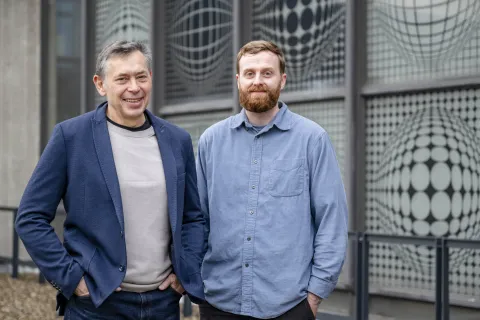Genetische Psychologie
Guter Stress, schlechter Stress
Ein Sport-Belastungstest und psychosozialer Stress erzeugen ähnliche Stresshormonanstiege. Trotzdem wird der erste positiv, der zweite negativ empfunden. Forscher suchen nach den Gründen.
Bei 15 Prozent Steigung auf dem Laufband geht es zunächst in einem erträglichen Tempo los, doch jede halbe Minute steigert sich die Geschwindigkeit, und die Probanden müssen schneller und schneller laufen – bis sie ihr Limit erreichen und aufhören müssen, weil die Beine nicht mehr wollen. Sich bis zu dieser physiologischen Grenze zu belasten bedeutet Stress für den Körper. Was macht das mit dem Organismus – und vor allem, wie unterscheidet sich diese Belastung von psychosozialem Stress, der sich hauptsächlich im Gehirn abspielt?

Wir möchten verstehen, wie der Stress vom Empfinden bis in die Zelle kommt – und wieder zurück.
Robert Kumsta
Diese Frage interessiert das Team am Lehrstuhl für Genetische Psychologie der RUB, und zwar bis ins Detail. „Wir möchten verstehen, wie der Stress vom Empfinden bis in die Zelle kommt – und wieder zurück“, beschreibt Prof. Dr. Robert Kumsta, Leiter des Lehrstuhls. „Wir wissen alle, dass Sport, gesunde Ernährung und positive soziale Kontakte Stresspuffer sind, aber wir wollen die körperlichen Mechanismen dahinter ergründen“, ergänzt er.

In einer ersten Studie, die der Lehrstuhl für Genetische Psychologie gemeinsam mit dem Team um Prof. Dr. Petra Platen aus der RUB-Fakultät für Sportwissenschaften durchführte, verglichen die Forscherinnen und Forscher, was auf physiologischer und emotionaler Ebene in einer körperlich oder psychosozial stressigen Situation passiert.
Lauf- und Stresstest
20 Sportstudenten nahmen an der Studie teil. „Wir haben Teilnehmer ausgewählt, die regelmäßig Sport machen und bereits einem Gesundheitscheck unterzogen worden waren, weil sie für die Studie auf dem Laufband bis an die Belastungsgrenze gehen mussten“, erklärt Dr. Dirk Moser aus der Genetischen Psychologie. Dieselben Probanden unterzogen sich außerdem dem sogenannten Trier Social Stress Test. Dabei absolviert der Proband ein nachgestelltes Job-Interview vor einem nüchtern agierenden Gremium und wird dabei gefilmt. Der Test ist in der Forschung etabliert und löst nachweislich Stress bei den Teilnehmern aus.

Zu verschiedenen Messzeitpunkten vor und nach der körperlichen oder psychosozialen Belastung füllten die Teilnehmer Fragebögen zum emotionalen Wohlbefinden aus. Gleichzeitig bestimmten die Forscher die Menge verschiedener Biomarker im Blut, beispielsweise der Stresshormone Cortisol und Noradrenalin.
Obwohl die Probanden bis zur äußersten Belastungsgrenze gelaufen waren, gaben sie anschließend an, sich gut und gestärkt zu fühlen, auch wenn sie erschöpft waren. Nach dem fiktiven Bewerbungsgespräch fühlten sie sich hingegen unwohl. Und die Blutwerte?
Überraschendes Ergebnis
„Ich hätte vorab gewettet, dass die körperliche Ausbelastung wesentlich höhere Stresshormonlevel produziert als ein fiktives Job-Interview“, erzählt Dirk Moser. „Aber die Werte gingen in beiden Situationen durch die Decke.“ Obwohl alle Teilnehmer wussten, dass es kein echtes Bewerbungsgespräch war, sorgte die soziale Bewertungssituation für Stressgefühle. „Es hat mich schon überrascht, dass das Gehirn ähnliche Kraftressourcen beanspruchen kann wie eine körperliche Ausbelastung, die so stark ist, dass man sie vermutlich nicht mehrmals am Tag erleben möchte“, vergleicht Moser.
Neuer Stress-Biomarker entdeckt
Die Cortisol- und Noradrenalin-Werte unterschieden sich also nicht zwischen beiden Situationen, und doch nahmen die Probanden die körperliche und psychosoziale Drucksituation sehr unterschiedlich wahr. Also suchten die Wissenschaftler nach einem anderen Biomarker, der in der Lage sein könnte, die unterschiedlichen Reaktionen zu erklären – und wurden fündig. Bei dem Marker handelte es sich nicht etwa um ein Hormon, sondern um zellfreie DNA.

Die Erbsubstanz liegt normalerweise im Zellkern vor, wird dort abgelesen und bleibt auch dort. Unter bestimmten Bedingungen findet sich DNA jedoch auch frei in der Blutbahn – ungeborene Kinder geben etwa DNA ab, die über die Nabelschnur in den Blutkreislauf der Mutter gelangt. Das Team vom Lehrstuhl Genetische Psychologie zeigte, dass sich auch unter Stress plötzlich zellfreie DNA im Blut findet. „In den Nukleotidbausteinen, aus denen die DNA aufgebaut ist, steckt viel Energie. Unter bestimmten Bedingungen gönnt sich die Zelle scheinbar trotzdem den Luxus, einige DNA-Bestandteile nach außen abzugeben“, erklärt Dirk Moser.
Ein zusätzlicher Stress-Kommunikationsweg?
„Es könnte sein, dass es neben dem Hormonsystem einen zusätzlichen Stress-Kommunikationsmechanismus über zellfreie DNA gibt, den noch niemand versteht“, sagt Robert Kumsta. „Anscheinend will der Körper damit etwas bezwecken; aber wir wissen noch nicht was.“
Klar ist, dass sowohl unter körperlicher als auch unter psychosozialer Belastung zellfreie DNA ins Blut abgegeben wird – aber aus unterschiedlichen Quellen, wie die Bochumer Analysen ergaben. Moser und Kumsta verglichen die zellfreie DNA aus den beiden Belastungssituationen, genauer die DNA-Methylierungsmuster, also die Muster bestimmter chemischer Gruppen, die Enzyme an die DNA anhängen, um den Ableseprozess zu regulieren. Zellfreie DNA, die unter psychosozialer Belastung im Blut zirkuliert, hatte ein anderes Methylierungsmuster als zellfreie DNA, die bei körperlichem Stress abgesondert wurde. „Das bedeutet, dass die DNA aus unterschiedlichen Zelltypen stammt“, erklärt Kumsta. „Wir können aber nicht sagen, aus welchen – das erfordert weitere Studien.“
Das Immunsystem scharfschalten
Bislang haben die Forscher daher nur eine unbestätigte Hypothese, auf was für einen Mechanismus sie mit ihrer Studie gestoßen sein könnten. Robert Kumsta und Dirk Moser könnten sich vorstellen, dass die zellfreie DNA eine Kommunikationsschleife zwischen Immunsystem, Muskeln und Gehirn bildet. „Auch Bakterien kommunizieren untereinander über DNA-Fragmente“, erklärt Dirk Moser. „Es könnte sich also um ein ursprüngliches Kommunikationssystem zwischen Zellen handeln, zusätzlich zur Kommunikation über Hormone und Stoffwechselprodukte.“

Die körpereigene zellfreie DNA könnte ein Training für die Immunzellen sein
Dirk Moser
Die Theorie: Unter körperlicher Belastung könnten die Muskelzellen zellfreie DNA abgeben, um mit dem Immunsystem zu interagieren. Auch krankmachende Bakterien geben DNA ab, wenn sie in den menschlichen Körper gelangen, und das Immunsystem reagiert darauf. „Die körpereigene zellfreie DNA könnte ein Training für die Immunzellen sein“, vermutet Dirk Moser. „Sie werden sozusagen scharfgeschaltet, sobald sie DNA im System bemerken.“ Das könnte auch erklären, warum sich Sport förderlich auf das Immunsystem auswirkt. Zellfreie DNA aus Gehirnzellen hingegen könnte eine gegensätzliche Wirkung auf das Immunsystem haben und psychosozialer Stress so dauerhaft krank machen.
Gehirn und Körper kommunizieren
„Stress ist eine Anpassungsleistung des Körpers“, so Robert Kumsta. „Wir wissen, dass es eine Kommunikation vom Gehirn an den Körper gibt und von dort zurück ans Gehirn.“ Über Stresshormone signalisiert das Gehirn dem Körper, zusätzliche Energiereserven bereitzustellen. Die Körperzellen wiederum signalisieren zurück, dass das passiert ist, und hemmen die Cortisolausschüttung. So reguliert sich das System bei gesunden Menschen selbst. Ähnlich kann das aktivierte Immunsystem über Entzündungsmarker mit dem Gehirn Signale austauschen. „Wir wissen also, dass es eine bidirektionale Kommunikation zwischen Gehirn und Körper gibt“, sagt Kumsta. „Mit unserer Studie stellen wir einen neuen Kommunikationsmechanismus in den Raum.“ Diesen wollen die Bochumer Wissenschaftler künftig genauer ergründen, unter anderem um herauszufinden, wie man Sport in der Psychotherapie nutzen kann, um therapeutische Effekte zu verstärken.