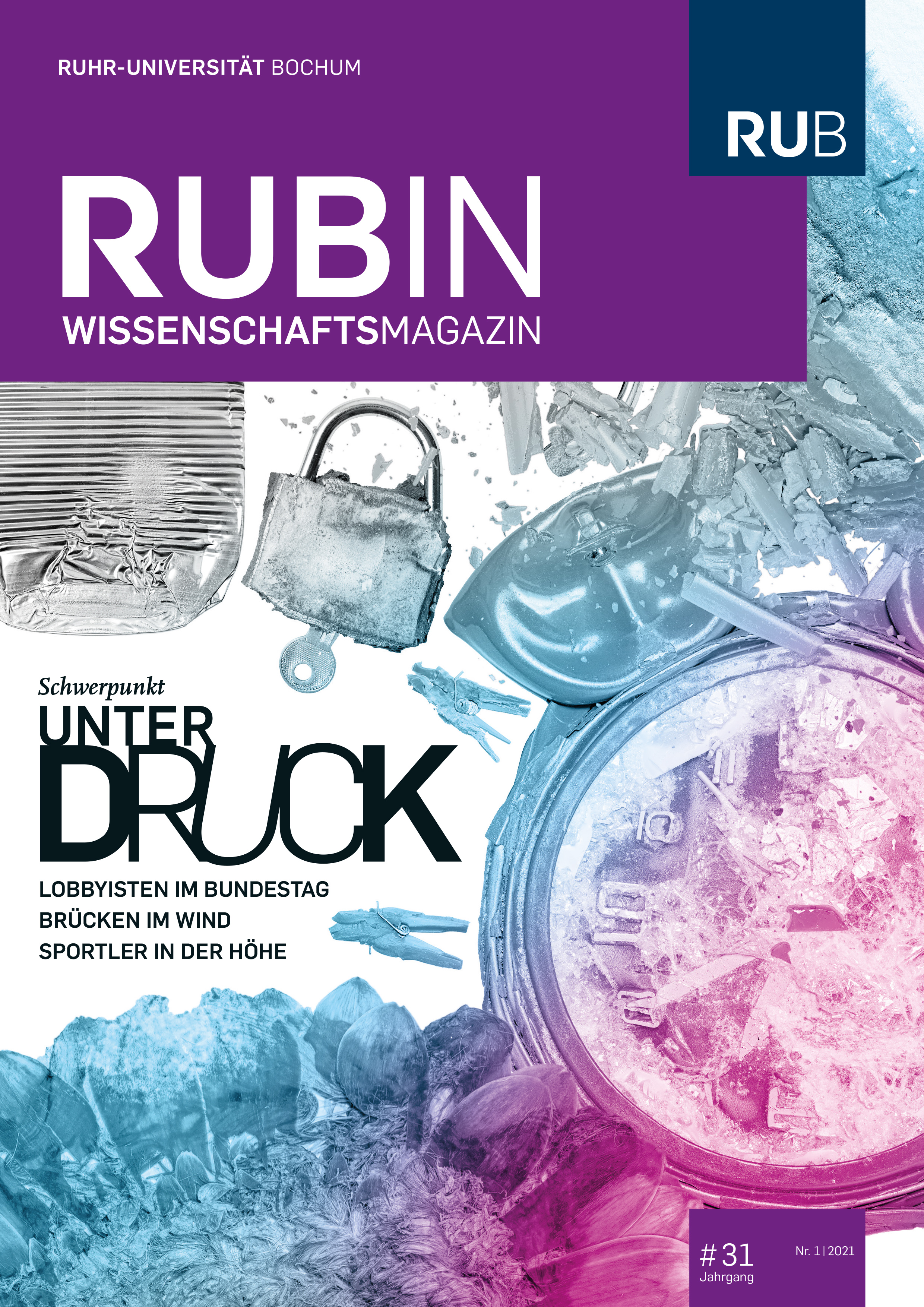Politikwissenschaft
Auf offener Bühne und hinter verschlossenen Türen
Interessengruppen nehmen unterschiedlich stark Einfluss auf Abgeordnete des deutschen Bundestages. Wirtschaftliche Interessen finden auf informellem Weg mehr Zugang als andere.
„Lobbyismus ist unheimlich intransparent. Das liegt in der Natur der Sache“, weiß Dr. Florian Spohr. Dem Politikwissenschaftler ist es dennoch gelungen, Interessengruppen hinter die Türen des Bundestages zu folgen und ihren Einfluss auf die deutsche Gesetzgebung zu messen. In seiner neuesten Studie vergleicht Spohr den informellen Zugang von Lobbyisten über die Vergabe von Hausausweisen mit dem institutionalisierten Zugang über Einladungen zu öffentlichen Anhörungen. Sein Fazit: „Lobbyismus im Bundestag stellt im Wesentlichen eine Unterstützung von organisierten Interessen für verbündete Abgeordnete dar. Fraktionen verschaffen den Lobbyisten Zugang, die ihnen inhaltlich nahestehen“.
Zu etwa jedem dritten Gesetzesentwurf, der aus der Bundesregierung kommt, finden öffentliche Anhörungen in den Ausschüssen des Bundestages statt. Hierzu werden Sachverständige eingeladen, zu denen neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitgeberverbänden, Agenturen, Kanzleien, Sozialverbänden, Verbraucherschutz- und Umweltschutzinitiativen, Gewerkschaften und Unternehmen zählen. „In den Anhörungen können die organisierten Interessen Stellung nehmen, Schwachstellen in den Entwürfen aufdecken, Änderungsbedarf oder auch Zustimmung äußern“, erläutert Spohr. Doch wie wirkt sich ihre Meinung zum Gesetzesentwurf am Ende auf das finale Gesetz aus? Wer trägt wie stark zu einer Gesetzesänderung bei?

Einladungen zu öffentlichen Anhörungen
Um das zu erfahren, wertete der ehemalige RUB-Wissenschaftler in einem Forschungsprojekt gemeinsam mit Projektleiter Prof. Dr. Rainer Eising und Simon Ress vom Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft fast 1.000 öffentliche Anhörungen aus. Die Forscher studierten die Positionen verschiedener Interessengruppen zu rund 600 unterschiedlichen Gesetzesentwürfen und kodierten sie entsprechend. „Wir haben die Positionspapiere je nach Haltung in fünf Kategorien eingeteilt: komplette Ablehnung, wesentliche Vorbehalte, neutral oder keine Positionierung, Zustimmung mit Korrekturwünschen, volle Zustimmung“, erklärt Spohr. Die dafür erforderlichen Stellungnahmen stehen allen Bürgerinnen und Bürgern online zur Verfügung und können von der Internetseite des Bundestages heruntergeladen werden. Die Änderung von Gesetzesentwurf zu Gesetz erfassten die Bochumer Wissenschaftler mit einem Algorithmus, den zwei Kollegen aus Dänemark und Irland entwickelt haben. Anschließend setzten sie Position und Gesetzesänderung per Regressionsanalyse in Verbindung.
Wirtschaftsinteressen fallen schwerer ins Gewicht
Das Ergebnis der quantitativen Analyse war eindeutig: „Wirtschaftliche Interessen haben deutlich mehr Einfluss als andere Interessen“, fasst Spohr zusammen. Der Politikwissenschaftler erläutert, wie sich die Verzerrung zugunsten der Wirtschaftsinteressen bemerkbar macht: „Ein Gesetzesentwurf, der von der Wirtschaft stark abgelehnt wird, aber von öffentlichen Interessengruppen eher befürwortet wird, wird am Ende stärker geändert, als ein Entwurf, den öffentliche Interessenvertreter ablehnen, aber die Wirtschaftslobby gutheißt.“
Hausausweise für Interessengruppen
Zu einem ganz ähnlichen Schluss kam Spohr auch, als er im Rahmen seiner Habilitation die Vergabe von Hausausweisen untersuchte. „Hausausweise für den Deutschen Bundestag erlauben es Lobbyisten, jederzeit ein- und auszugehen, gemeinsam mit Abgeordneten in der Kantine zu essen und in deren Büros vorstellig zu werden“, führt der Wissenschaftler aus. Normalerweise entscheide die Bundestagsverwaltung, wer einen solchen Ausweis bekomme, und vergebe ihn nur an Verbände und Vereine. Bis Ende 2015 gab es aber ein Schlupfloch: Auch die Fraktionen konnten Hausausweise vergeben. Daten über die von ihnen vergebenen Ausweise musste der Bundestag Ende 2015 nach einer Klage des Portals abgeordnetenwatch.de herausgeben. Für Spohr war das die einmalige Gelegenheit, einen Einblick in ein System zu gewinnen, das sonst unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitet.
Informelle Einflussnahme
Der Lobbyismus-Forscher fand heraus, dass die Fraktionen keineswegs allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen gleichberechtigt Zugang zum Bundestag erlaubten. „Die Verteilung der Hausausweise war asymmetrisch zugunsten wirtschaftlicher Interessen. Über die Hälfte der Interessenvertreter mit Hausausweisen waren Vertreter von Unternehmen, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden“. Spohrs Studie zeigte auch, dass Parteien vornehmlich Interessengruppen einluden, die ihnen politisch nahestanden. Darüber hinaus beobachtete er eine Vielzahl neuer Akteure, die über die Hausausweise informell den Kontakt zu Abgeordneten suchten.
Unterschiedliche Zugangsmuster
In seiner aktuellen Studie betrachtet Spohr die beiden Wege der Einflussnahme, über öffentliche Anhörungen und Hausausweise, vergleichend. Seine Analyse legt deutliche Unterschiede in den Zugangsmustern von wirtschaftlichen und öffentlichen Interessengruppen offen. „Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie Unternehmen besitzen weitaus häufiger Hausausweise als andere Interessengruppen. Sie bevorzugen diesen informellen, verborgenen Zugang, um ihre Bedürfnisse und Vorstellungen zu äußern“, so Spohr. Öffentliche Interessengruppen wie Gewerkschaften und Wohlfahrtverbände hingegen würden überproportional oft auf die öffentliche Bühne der Anhörungen gebeten werden. „Gemeinwohl-orientierte Interessengruppen sind interessant für die Abgeordneten, weil sie häufig populäre Themen oder große gesellschaftliche Gruppen repräsentieren, und damit entscheidende Wählerstimmen oder deren Entzug in Aussicht stellen“, weiß Spohr. Die Daten würden ferner zeigen, dass Regierungsfraktionen gezielt öffentliche Interessengruppen in Anhörungen einladen, um Regierungsinitiativen zu unterstützen. Wirtschaftsnahe Lobbygruppen würden hingegen eher eingeladen, um Änderungsbedarf an Gesetzesentwürfen der Regierung aufzuzeigen.
Lobbyismusforschung für Fortgeschrittene
Spohrs Forschungsprojekte verdeutlichen auch, welche Hürden genommen werden müssen, um an Datensätze zu gelangen. Nur dank einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg war die Bundestagsverwaltung gezwungen, Informationen zur Vergabe der Hausausweise bereitzustellen. Weniger Glück hatte Spohr, als er, inspiriert von einem Ansatz seiner dänischen Kollegen, Briefwechsel zwischen Lobbyisten und gewählten Volksvertretern auswerten wollte. Die Bundestagsverwaltung lehnte seine Anfrage mit Verweis auf den Datenschutz ab. „Wird hier Datenschutz als Ausrede für Intransparenz angeführt?“, fragt sich Spohr.
Mehr Transparenz unabdingbar
Seit der Neuregulierung der Hausausweisvergabe im Jahr 2016 können Privatunternehmen, Stiftungen, Think Tanks, Agenturen und Kanzleien keine Hausausweise mehr beantragen. Wie finden ihre Interessen nun Gehör? „Die Neuregelung macht das ganze System unübersichtlich“, bemängelt Spohr. Der Politikwissenschaftler befürchtet: „Da nach der geänderten Regelung seit Anfang 2016 Hausausweise wieder nur von der Verwaltung an Vereine und Verbände ausgegeben werden, die anderen Akteure aber weiterhin da und auch teils gefragte Gesprächspartner sind, droht sich das Lobbying in eine noch weniger kontrollierte Grauzone außerhalb der Parlamentsgebäude zu verschieben.“ Spohr hält daher eine stärkere Regulierung für unabdingbar. „Es bedarf dringend der Erschließung weiterer Datenquellen.“ Der Forscher plädiert für die Einführung eines Lobbyregisters, welches die Kontakte von organisierten Interessen zu Abgeordneten dokumentiert und auch deren finanzielle Lobbyaufwendungen offenlegt. Das würde mehr Transparenz schaffen. Gut für die Bürgerinnen und Bürger – und für die politikwissenschaftliche Forschung.