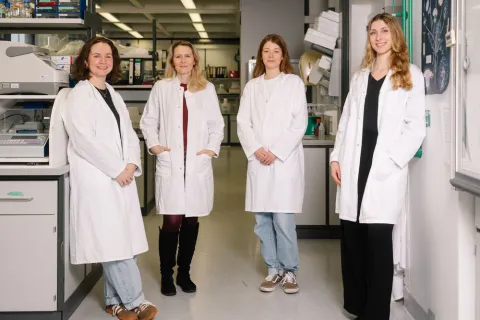Die Leichen, die in den anatomischen Theatern präpariert wurden, stammten oft von Hingerichteten.
Geschichte der Architektur
Eine Bühne für die Wissenschaft
In Anatomischen Theatern fanden ab der frühen Neuzeit öffentliche Zergliederungen von Leichen statt. Ein Akt zwischen Sichtbarmachung und Verschleierung.
Hoch aufsteigende, kreisförmig angeordnete Ränge, von denen die Zuschauer einen guten Blick auf den in der Mitte platzierten Seziertisch hatten, ein oftmals prunkvoller Bau, der von einem Förderer der Wissenschaft mitfinanziert wurde – dies sind die architektonischen Merkmale, die einem bei Betrachtung eines Anatomischen Theaters aus der Frühen Neuzeit direkt ins Auge fallen. Dass diese Anatomischen Theater eine gänzlich andere Funktion innehatten als Präpariersäle in modernen Universitäten, hat Kunsthistorikerin Prof. Dr. Christine Beese vom Arbeitsbereich Architekturgeschichte der Ruhr-Universität Bochum erforscht.
„Die Zergliederungen der Leichen fanden vor öffentlichem Publikum statt. Dazu gab es eine naturphilosophische Vorlesung in Anlehnung an Aristoteles, in der es weniger darum ging, bestimmte Krankheiten zu erkennen, als vielmehr darum zu lernen, wie der ideale Körper aufgebaut ist“, so Beese. Die Atmosphäre war weniger nüchtern und medizinisch als heute. Der Raum war abgedunkelt, Kerzen sorgten für eine theatralische Stimmung, in den Pausen wurde Musik gespielt. Darüber berichtet Rubin, das Wissenschaftsmagazin der Ruhr-Universität Bochum.
Man wollte den Bauplan Gottes für die Welt entschlüsseln
Den Menschen des ausgehenden 16. Jahrhunderts dienten solche Aufführungen der umfassenden Bildung. Sie erfuhren hier nicht nur etwas über den menschlichen Körper, sondern auch etwas über sich selbst und den Bauplan Gottes für die Welt, denn damals war man der Überzeugung, dass der menschliche Körper als Mikrokosmos den Makrokosmos, also die Erde und das Weltall, wiederspiegelt und beides miteinander eng verwoben ist.
„Die Zergliederungen dienten der Bildung und Sichtbarmachung, aber auch eine Inszenierung, die darauf setzte, dass es Geheimnisse der Natur gibt, die diese von selbst nicht preisgibt“, so Christine Beese.
Ihr Wunsch für ihre Forschungsarbeit: „Viele dieser Räume werden in der Öffentlichkeit nicht als Kunstwerke wahrgenommen. Ich möchte das ändern. Der Kunstwerk-Charakter war Teil ihrer Aufgabe bei der Wissenserzeugung“, so Christine Beese.
Ausführlicher Artikel im Wissenschaftsmagazin Rubin